- Allgemeines Recht
- Lesezeit: 06:10 Minuten
Salvatorische Klausel: Formulierung, Beispiel & Muster
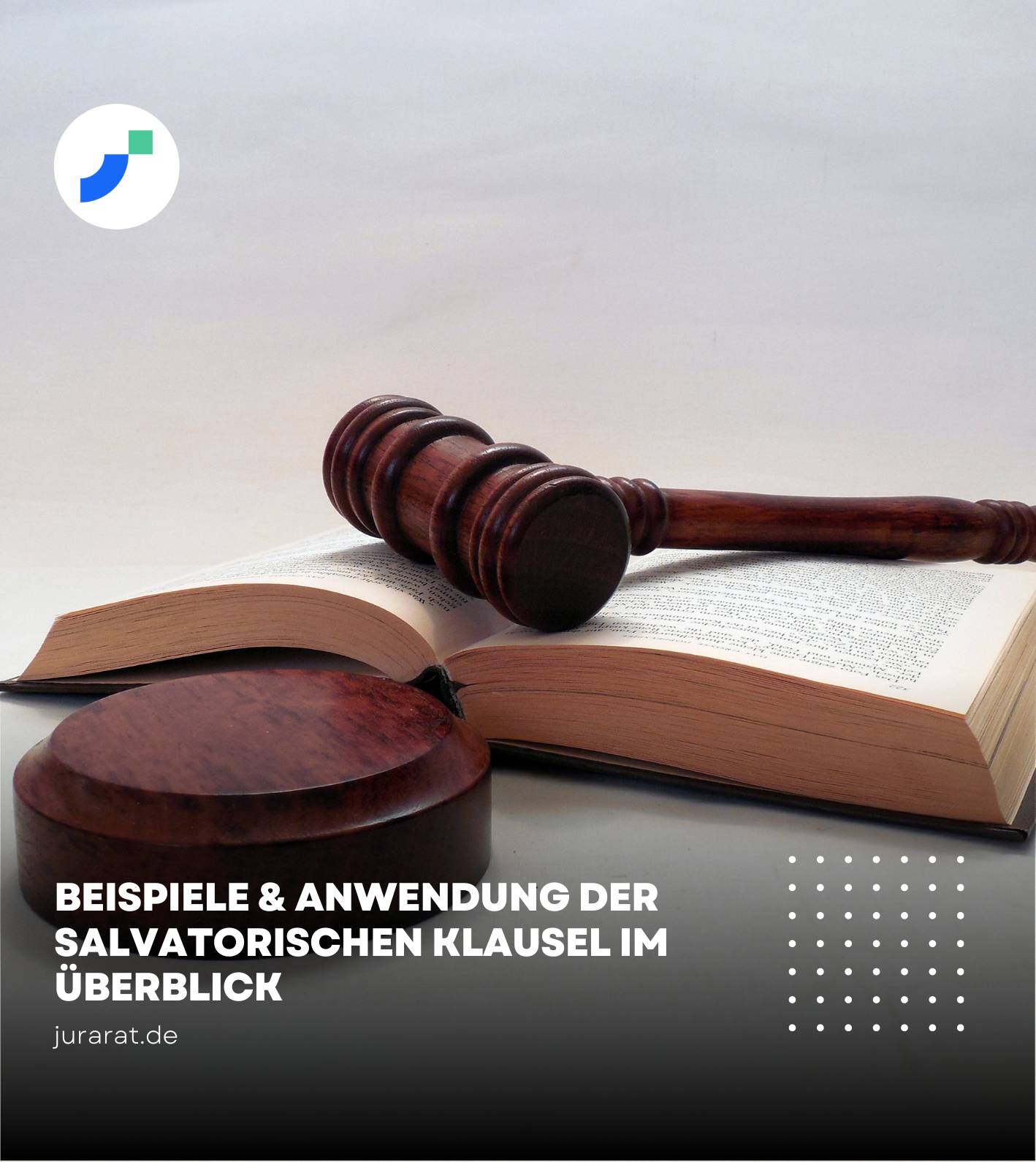
- Die salvatorische Klausel entstand aus der Carolina von 1532, um die Macht der Reichsstände im Heiligen Römischen Reich zu bewahren.
- Salvatorische Klauseln dienen dazu, die Gültigkeit eines Vertrages zu erhalten, selbst wenn einzelne Teile unwirksam sein sollten.
- Sie besteht aus einer Erhaltungsklausel, die die Gültigkeit des restlichen Vertrages sichert, und einer Ersetzungsklausel, die eine unwirksame Bestimmung ersetzt.
- Es besteht keine Verpflichtung, salvatorische Klauseln zu verwenden; sie sind in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sogar grundsätzlich unwirksam.
- In Individualverträgen sind salvatorische Klauseln sinnvoll und wirksam, um die Gesamtnichtigkeit bei unwirksamen Klauseln zu vermeiden.
- In AGB ist die Verwendung salvatorischer Klauseln zu vermeiden, da das AGB-Recht eigene Regelungen für unwirksame Klauseln vorsieht.
Ob beim Einkauf in Online-Shops, im Supermarkt, beim Abschluss eines Arbeitsvertrages oder im Rahmen millionenschwerer Gesellschafts- und Umwandlungsverträgen: Vertragsklauseln sind im Rechtsverkehr heutzutage allgegenwärtig und nicht mehr wegzudenken. Den beteiligten Parteien kommt es insbesondere darauf an, auf die rechtliche Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages vertrauen zu können. Um diese Wirksamkeit gewährleisten zu können, haben sich in der Vertragspraxis sogenannte salvatorische Klauseln etabliert.
Welchen Ursprung hat die salvatorische Klausel?
Der Ursprung der salvatorischen Klausel liegt in dem wichtigsten Gesetz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der sogenannten Carolina von 1532. Zu Zeiten Kaiser Karls V. regelte die Carolina den Strafprozess und das materielle Strafrecht in seinem Herrschaftsgebiet. Um dieses Gesetz zu verabschieden, benötigte Kaiser Karl V. die Zustimmung der Reichsstände, also der Personen, die Sitz und Stimme im Reichstag besaßen. Da diese durch eine gesamtdeutsche Vereinheitlichung des Straf- und Strafprozessrechts aber erhebliche Machteinbußen vermuteten, verweigerten viele von Ihnen diese Zustimmung.
Um doch noch die Akzeptanz des Gesetzes zu erwirken, wurde eine abschließende Bestimmung in das Gesetz eingefügt, wonach die Vorschriften der Carolina die Machtbefugnisse der Landesherren, Reichsstädte und ihre für Strafsachen zuständigen Gerichte unberührt lassen. Hierdurch wurden die meisten von ihnen für das Gesetz gewonnen, die erste salvatorische Klausel war geboren.
Warum heißt es salvatorische Klausel?
Schon aus dem Zweck und der Rechtsfolge der ersten salvatorischen Klausel der Geschichte wird der Grund für diese Namensgebung deutlich: Durch die in die Carolina eingefügte Bestimmung wurden die Machtbefugnisse der Reichsstände bewahrt und erhalten. Übersetzt man diese Verben ins lateinische, ergibt sich hieraus der Begriff „salvatorius“, der als Grundlage für die Bezeichnung der salvatorischen Klausel dient.
Was ist eine salvatorische Klausel und was ist deren Zweck?
Um das Erfordernis und die Funktionsweise einer salvatorischen Klausel zu verstehen, muss zunächst ein kurzer Überblick über die gesetzliche Ausgangslage geschaffen werden. Ausgangspunkt salvatorischer Klauseln ist stets § 139 BGB. Erweisen sich demnach einzelne Vertragsklauseln innerhalb eines Vertrages als unwirksam, so führt dies dazu, dass der gesamte Vertrag nichtig ist, wenn nicht anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne den nichtigen Teil abgeschlossen worden wäre. Hierbei muss auf den mutmaßlichen Willen der Vertragsparteien abgestellt werden, was im Zweifel durch den Richter im Wege der Interessenabwägung unter Berücksichtigung des Vertragszwecks geschieht.
Praxisrelevant ist dabei jedoch insbesondere die von § 139 BGB aufgestellte Vermutung der Nichtigkeit. Dies führt dazu, dass die Partei, die die Gültigkeit des Vertrages für sich in Anspruch nimmt, die Beweislast für diejenigen Tatsachen trägt, aus denen sich ergibt, dass der Vertrag auch ohne den nichtigen Teil abgeschlossen worden wäre. Diese konkret zu beweisen, ist im Zweifel ein ziemlich schwieriges Unterfangen.
Des Weiteren vertrauen die Vertragspartner auf die Wirksamkeit des Vertrages. Führt die Unwirksamkeit einer einzelnen Vertragsklausel nun aber zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages, geht damit die von den Parteien unerwünschte Rechtsfolge der Rückabwicklung einher, die sich insbesondere bei langfristigen Verträgen als schwierig erweist.
Sowohl die Beweisführungsschwierigkeiten als auch die Problematik der Gesamtnichtigkeit des Vertrages können in der Praxis mit der Aufnahme salvatorischer Klauseln in das Vertragswerk vermieden werden, Verträge können also trotz Nichtigkeit einzelner Bestandteile ihre Gültigkeit bewahren.
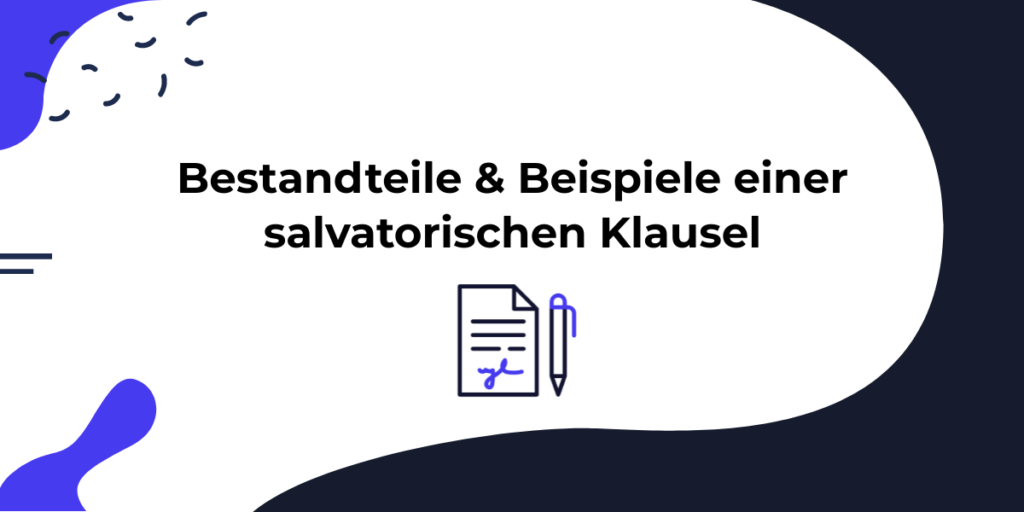
Welche Bestandteile hat eine salvatorische Klausel?
Salvatorische Klauseln beinhalten regelmäßig zwei Komponenten: Zum einen eine Erhaltungsklausel, zum anderen eine Ersetzungsklausel.
In der Erhaltungsklausel wird vereinbart, dass die Parteien nicht die in § 139 BGB genannte Rechtsfolge der Gesamtnichtigkeit, sondern die Gültigkeit des restlichen Vertrages wollen.
Demgegenüber wird in der Ersetzungsklausel geregelt, welche Regelung an die Stelle der nichtigen Vertragsklausel treten soll.
Dies kann einerseits so ausgestaltet sein, dass hierdurch eine Neuverhandlungspflicht begründet wird, in Folge derer dann die zur Abänderung des Vertrages erforderlichen Willenserklärungen abgegeben werden. (sog. „obligatorische Ersetzungsklausel“). Andererseits können für den Fall der Nichtigkeit bereits konkrete Ersatzregelungen bestimmt worden sein, die dann den Vertragsinhalt unmittelbar ändern. (sog. Fiktionsklausel). Eine Neuverhandlung des Vertragsinhalts ist somit nicht erforderlich, der Inhalt wird unmittelbar durch die konkrete Ersatzregelung festgelegt.
Beispiele einer salvatorischen Klausel
Salvatorische Klauseln können in der Praxis in verschiedenen Variationen auftreten, was das folgende Beispiel zeigt:
"Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein sollten, oder dieser Vertrag ausfüllungsbedürftige Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt."
Folgende Klausel erfüllt denselben Zweck und nennt die Komponente der (obligatorischen) Ersetzungsklausel sogar ausdrücklich:
„Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, nichtig sein oder nichtig werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen/nichtigen Bestimmung werden die Parteien eine solche Bestimmung treffen, die dem mit der unwirksamen/nichtigen Bestimmung beabsichtigten Zweck am nächsten kommt. Dies gilt auch für die Ausfüllung eventueller Vertragslücken.“
Ist eine salvatorische Klausel Pflicht?
Eine Verpflichtung zur Verwendung salvatorischer Klauseln besteht nicht. Als allgemeine Regel enthält § 139 BGB für die Fälle, in denen an eine salvatorische Klausel zu denken wäre, eine Auslegungsregel bereit, sodass der Fall der Nichtigkeit einzelner Vertragsbestandteile schon durch das Gesetz geregelt wird: Wie bereits dargestellt, entspricht diese jedoch häufig nicht dem Interesse der Parteien. Innerhalb Individualvereinbarungen, also Verträgen, die nur für einen konkreten Einzelfall ausgestaltet werden, ist die Verwendung salvatorischer Klauseln durchaus begründet und eine wirksame Gestaltung möglich.
Auch innerhalb allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind salvatorische Klauseln keinesfalls zwingend. Vielmehr ist die Verwendung salvatorischer Klauseln in AGB sogar grundsätzlich unwirksam: Das AGB-Recht selbst hält nämlich eine eigene Regelung bereit, die die Rechtsfolge für einzelne unwirksame AGB Klauseln vorschreibt. Gemäß § 306 Abs. 1 BGB bleibt der Vertrag dann im Übrigen wirksam, nach § 306 Abs. 2 BGB richtet sich der Inhalt des Vertrages dann nach den gesetzlichen Vorschriften.
Neben der Unwirksamkeit der Klausel riskiert der Verwender salvatorischer Klauseln zusätzlich, kostenpflichtige Abmahnungen von Verbänden und/oder Wettbewerbern zu erhalten. Im Rahmen von AGB sollte auf salvatorische Klauseln daher unbedingt verzichtet werden.
Zusammenfassung: Die salvatorische Klausel
Salvatorische Klauseln gelten mittlerweile als Vertragsstandard und werden benutzt, um die Nichtigkeitsfolge des § 139 BGB zu verhindern. Ihren Ursprung haben Sie in der Carolina von 1532, die den Strafprozess und das Strafrecht des Heiligen Deutschen Reiches Deutscher Nation regelte. Salvatorische Klauseln bestehen in der Regel aus einer Erhaltungsklausel und einer Ersetzungsklausel. Eine Pflicht zur Verwendung salvatorischer Klauseln besteht nicht. Die Wirksamkeit salvatorischer Klauseln hängt stets vom Einzelfall ab. Während die Verwendung in Individualverträgen aber grundsätzlich keine Probleme bereitet, ist die Verwendung salvatorischer Klauseln in AGB im Grundsatz unwirksam und sollte daher vermieden werden.

Häufig gestellte Fragen zur salvatorischen Klausel
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was ist eine salvatorische Klausel, einfach erklärt?
Die salvatorische Klausel ist ein Vertragsbestandteil, der dazu dient, die Gültigkeit des restlichen Vertrages auch dann zu gewährleisten, wenn einzelne Bestandteile des Vertrages unwirksam sein sollten. Diese Klausel soll also sicherstellen, dass der gesamte Vertrag nicht aufgrund der Unwirksamkeit einer einzelnen Klausel null und nichtig wird.
Wie lautet die salvatorische Klausel?
Eine salvatorische Klausel könnte beispielsweise so lauten:
“Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung beabsichtigten Zweck am nächsten kommt.”
Sind salvatorische Klauseln zulässig?
Ja, salvatorische Klauseln sind grundsätzlich zulässig und werden in der Vertragspraxis häufig verwendet, um die Wirksamkeit des Gesamtvertrages zu gewährleisten. Allerdings sind sie in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) generell unwirksam, da das AGB-Recht selbst eine Regelung für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Klauseln vorsieht.
Wann ist eine salvatorische Klausel notwendig?
Eine salvatorische Klausel ist immer dann sinnvoll, wenn die Parteien eines Vertrages sicherstellen möchten, dass der Vertrag auch dann seine Gültigkeit behält, wenn einzelne Klauseln unwirksam sein sollten. Sie hilft, die Rechtsunsicherheit zu minimieren, die durch die mögliche Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestandteile entstehen könnte. Besonders in komplexen Verträgen, bei denen die Unwirksamkeit einer einzelnen Klausel den gesamten Vertrag gefährden könnte, ist die Verwendung einer salvatorischen Klausel ratsam. Es besteht jedoch keine rechtliche Pflicht zur Aufnahme einer solchen Klausel in einen Vertrag.