- Allgemeines Recht
- Lesezeit: 08:47 Minuten
Drittschadensliquidation: Pflichten, Anspruch & Beispiel

- Drittschadensliquidation tritt auf, wenn der Schaden und der Anspruch nicht bei derselben Person liegen.
- Voraussetzungen sind u.a., dass der Gläubiger Anspruch, aber keinen Schaden hat, und der Dritte Schaden, aber keinen Anspruch hat.
- Dies kann in Situationen wie Werkuntergang, Versendungskauf, Vermächtnis, mittelbarer Stellvertretung und Treuhandverhältnissen auftreten.
- Der erlittene Schaden wird zur Anspruchsgrundlage des Gläubigers.
- Drittschadensliquidation unterscheidet sich vom Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, bei dem der Dritte einen direkten Anspruch erhält.
Drittschadensliquidation ist ein komplexes, aber wichtiges Konzept im Recht, das greift, wenn die Person, die einen Schaden erlitten hat, keinen Anspruch gegen den Schädiger hat, während eine andere Person, die keinen Schaden erlitten hat, einen Anspruch hat. Dieses Phänomen kann in verschiedenen Situationen auftreten und erfordert eine sorgfältige Untersuchung der Umstände und der beteiligten Personen. Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, wie z.B. die Art des Schadens, die Beziehung zwischen den Parteien und die spezifischen rechtlichen Voraussetzungen. Die folgenden Abschnitte werden diesen komplizierten, aber faszinierenden Aspekt des Rechts näher beleuchten.
Die Ausgangssituation
Den Schaden, der aus einer Vertragsverletzung entsteht, kann der Gläubiger grundsätzlich so weit geltend machen, wie er bei ihm selbst eingetreten ist. Ist dem Gläubiger also gar kein Schaden entstanden, kann er diesen logischerweise nicht ersetzt verlangen.
Wirkt sich die Pflichtverletzung auf das Vermögen eines Dritten aus, schädigt diesen also, so kann der Dritte den Schädiger nur dann in Anspruch nehmen, wenn ihm selbst eine eigene Anspruchsgrundlage zusteht.
Nun sind aber Situationen denkbar, in denen eine Person zwar einen Schaden erlitten, jedoch keine Anspruchsgrundlage gegenüber dem Schädiger hat, während einer anderen Person eine Anspruchsgrundlage zur Verfügung steht, ihr jedoch gar kein Schaden entstanden ist. In dieser Fallkonstellation wäre es unbillig, den Schuldner nur aufgrund eines zufälligen Auseinanderfallens von Anspruch und Schaden ungeschoren davonkommen zu lassen. Genau an diesem Punkt greift das Rechtsinstitut der Drittschadensliquidation: Ausnahmsweise kann der Vertragspartner auch den Schaden des Dritten beim Gläubiger liquidieren, also geltend machen, da der Schaden zum Anspruch gezogen wird (dazu unter III. mehr)
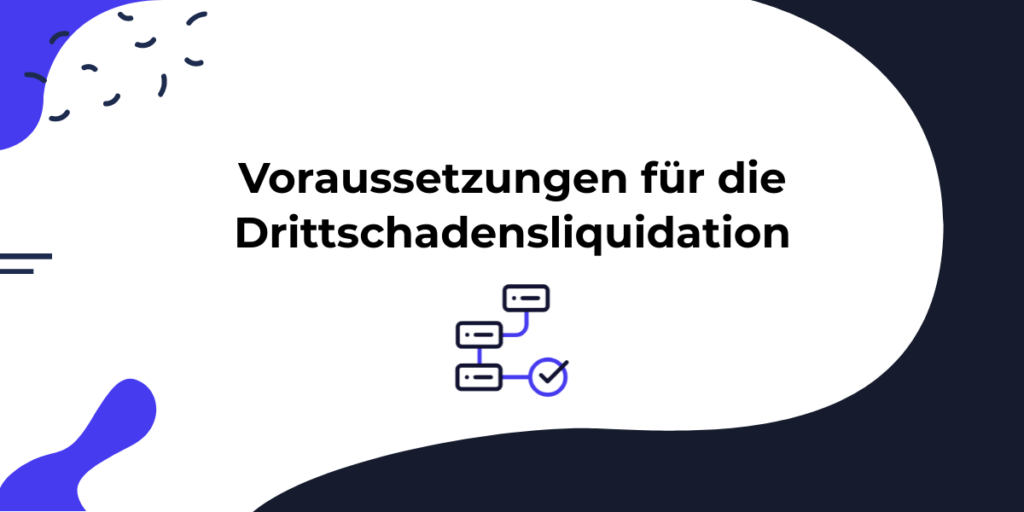
Welche Voraussetzungen müssen für die Drittschadensliquidation erfüllt sein?
Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Voraussetzungen der Drittschadensliquidation erfüllt sind, die nun erläutert werden.
- Der Gläubiger hat dem Grunde nach einen Schadensersatzanspruch gegen den Schuldner, aber keinen Schaden erlitten.
- Der Dritte hat einen vom Schuldner verursachten Schaden erlitten, aber keinen vertraglichen Anspruch gegen den Schuldner auf Ersatz dieses Schadens. (Beachte: Deliktische Ansprüche des Dritten gegen den Schuldner, beispielsweise aus § 823 I BGB, schließen die Drittschadensliquidation nicht aus!)
- Für den Schuldner erfolgte das Auseinanderfallen von Anspruch und Schaden zufällig, weil es auf einem vom Schuldner nicht beeinflussbaren Rechtsverhältnis beruht.
Diese geforderte Zufälligkeit der Schadensverlagerung ist in folgenden Fallkonstellationen erfüllt:
a) Werkuntergang vor der Abnahme, § 644 I BGB
Eine zufällige Schadensverlagerung liegt dann vor, wenn ein Werk im Sinne des Werkvertragsrechts durch Verschulden eines Dritten untergeht, noch bevor es vom Auftraggeber (im Werkvertragsrecht"Besteller"genannt), abgenommen wurde.
Diese Situation lässt sich anhand eines Beispiels erläutern:
A baut ein Haus für sich und seine Familie. Er beauftragt Fliesenleger F, das Bad zu fließen. Die Sanitärarbeiten soll S übernehmen. S vergisst nun fahrlässig, ein Wasserventil zu schließen, sodass das gesamte Bad unter Wasser steht, bevor die Fließen bzw. der Fliesenkleber trocknen konnte.
A steht nun ein Schadensersatzanspruch gegen den S zu, jedoch hat er keinen Schaden, da der Fliesenleger ihm nach wie vor das Verlegen der Fliesen schuldet, §§ 644 I, 632 I BGB.
Dem F ist ein Schaden entstanden, jedoch hat er keinen vertraglichen Anspruch gegenüber dem S, da er nie in einem Vertragsverhältnis zu diesem stand.
Das mit diesem Beispiel dargestellte Auseinanderfallen von Anspruch und Schaden beruht auf § 644 I BGB, der alleine das Verhältnis zwischen A und F betrifft. Aus Sicht des S ist dieses Auseinanderfallen zufällig, da er es nicht beeinflussen kann.
b) Versendungskauf, § 447 I BGB
Sofern sich Käufer und Verkäufer im Rahmen eines Versendungskaufs, § 447 BGB, auf eine Schickschuld einigen und die Kaufsache beim Transport untergeht, wird der Verkäufer von seiner Pflicht aus § 433 I S. 1 BGB nach § 275 I BGB frei.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs geht bereits mit Übergabe der Kaufsache an die Transportperson, vom Verkäufer auf den Käufer über. Der Verkäufer behält dann, entgegen § 326 I S. 1 BGB, seinen Gegenanspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 II BGB. Das ergibt Folgendes:
Der Verkäufer hat einen Schadensersatzanspruch gegen den Transporteur der Kaufsache. Allerdings hat er keinen Schaden erlitten, schließlich kann er weiterhin die Zahlung des Kaufpreises vom Käufer verlangen.
Der Käufer hingegen erleidet einen Schaden: Er muss den Kaufpreis bezahlen, ohne die Kaufsache zu erhalten. Ihm steht kein vertraglicher Anspruch gegen den Transporteur zu, da er nie mit diesem in vertraglichen Kontakt kam.
Aus Sicht des Transporteurs ist das Auseinanderfallen von Schaden und Anspruch zufällig. Für ihn ist es nämlich völlig irrelevant, wer im Innenverhältnis zwischen seinem Auftraggeber (Verkäufer) und dem Adressaten (Käufer) das Risiko trägt.
c) Vermächtnis
Wird die dem Vermächtnisnehmer vermachte Sache, die sich noch im Eigentum des Erben befindet, durch das Verschulden eines Dritten zerstört, so begründet das einen Schadensersatzanspruch des Erben gegen den Dritten aus § 823 I BGB. Da die Sache jedoch einem anderen vermacht wurde, muss der Erbe diese Sache "ohnehin" nach § 2174 BGB an den Vermächtnisnehmer übereignen. Somit ist dem Erben kein Schaden entstanden.
Vielmehr ist aber dem Vermächtnisnehmer ein Schaden entstanden, schließlich erhält er den Vermächtnisgegenstand nun nicht mehr. Gegen den Schädiger hat er keinen vertraglichen Anspruch.
Aus Sicht des Dritten erfolgte diese Schadensverlagerung zufällig, er hat keinen Einfluss hierauf.
d) mittelbare Stellvertretung
Das deutsche Recht erlaubt, Verträge im eigenen Namen, aber für Rechnung eines anderen abzuschließen. In dieser Situation wird die Person, die den Vertrag im eigenen Namen abschließt, als dem Vertrag selbst berechtigt, obwohl die wirtschaftlichen Folgen im Ergebnis einen anderen treffen sollen. Auch in dieser Konstellation ist eine Drittschadensliquidation denkbar.
Hierzu folgendes Beispiel:
Millionär M ist seit jeher ein begeisterter Oldtimer-Fan. Da er sich einen neuen Oldtimer zulegen möchte, jedoch das Haus nicht gerne verlässt und als Käufer des 1,1 Millionen teuren Oldtimers nicht erkannt werden möchte, beauftragt er seinen besten Freund F (ebenfalls Millionär), bei der nächsten Oldtimerauktion einen Oldtimer im eigenen Namen zu ersteigern. Den Kaufpreis werde M dem F im Anschluss natürlich erstatten. Kurz nachdem der F den Oldtimer ersteigert hatte, rennt der neidische N auf die Bühne und zerstört den Oldtimer.
F hat als Eigentümer des Oldtimers einen Schadensersatzanspruch gegen den N aus § 823 I BGB, jedoch keinen Schaden, da er den Kaufpreis von M gemäß § 670 BGB erstattet verlangen kann.
M hat keinen Schadensersatzanspruch gegen N, jedoch erleidet er einen Schaden dadurch, dass er dem F 1,1 Millionen Euro gemäß § 670 BGB schuldet.
Dass F den Oldtimer im eigenen Namen, aber für Rechnung des M ersteigerte, ist aus Sicht des N zufällig gewesen.
e) Treuhandverhältnisse
Auch in der praxisrelevanten Konstellation eines Treuhandverhältnisses kann schnell es zum Auseinanderfallen von Anspruch und Schaden kommen. Der Treuhänder verwaltet ausschließlich fremdes Vermögen. Falls dieses geschädigt wird, hat er einen Anspruch gegen den Schädiger, jedoch keinen Schaden, da es ja nicht um sein eigenes Vermögen geht. Gleichzeitig hat der Treugeber, also die Person, die dem Treuhänder ihr Vermögen überlässt, einen Schaden erlitten, ohne einen vertraglichen Anspruch dem Schädiger gegenüber zu haben.
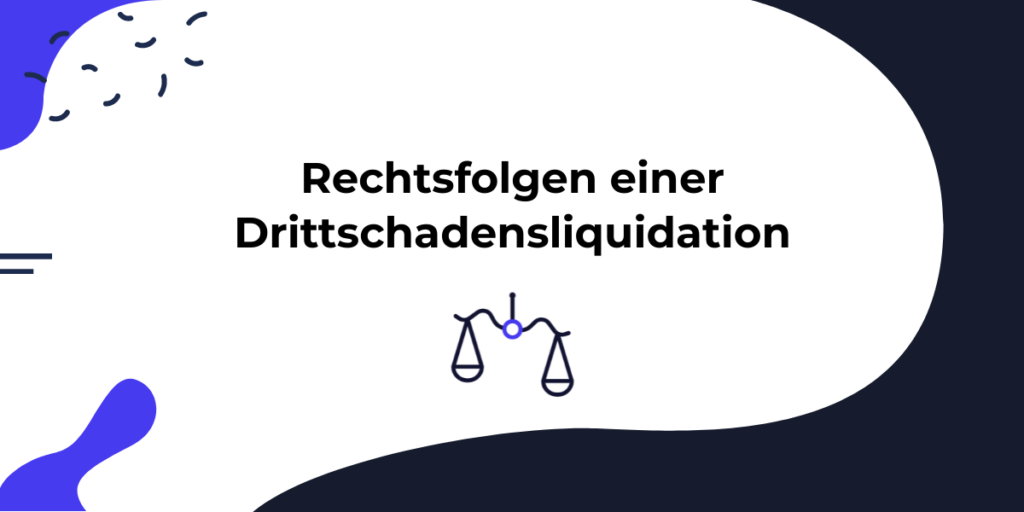
Welche Rechtsfolgen hat die Drittschadensliquidation?
Unmittelbare Rechtsfolge der Drittschadensliquidation ist, dass der erlittene Schaden zur Anspruchsgrundlage gezogen wird. Damit ist nun nicht der wirtschaftlich Leidtragende, der den Schaden erlitten hat, in der Position, seinen Schaden beim Schädiger zu liquidieren, sondern der Gläubiger, der ja überhaupt keinen Schaden erlitten hat.
Dieses Ergebnis wird durch Treu und Glauben, § 242 BGB, korrigiert, indem der Gläubiger dem Geschädigten die Liquidation ermöglichen muss.
Sofern der Gläubiger den Anspruch bereits gegenüber dem Schädiger geltend gemacht und dieser schon Schadensersatz gezahlt hat, muss der Gläubiger diesen an den Geschädigten weiterleiten.
Falls der Gläubiger den Anspruch bislang nicht gegenüber dem Schädiger geltend gemacht hat, muss er den Anspruch gegen den Schädiger an den Geschädigten abtreten.
Somit führt die Drittschadensliquidation im Ergebnis dazu, dass der Geschädigte seinen Schaden doch noch ersetzt bekommt.
Abgrenzung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
Häufige (und besonders schwer zu erkennende!) Abgrenzung in juristischen Klausuren ist zwischen der Drittschadensliquidation und dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorzunehmen.
Klassischer Fall des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ist folgender:
Mutter M geht mit ihrem fünfjährigen Kind K im Supermarkt einkaufen. Aufgrund einer Unachtsamkeit des Supermarktpersonals liegt ein Salatblatt auf dem ohnehin schon rutschigen Supermarktboden. Kind K rutscht aus und verletzt sich.
Da das Kind keinen Vertrag mit dem Supermarkt abgeschlossen hat, hat es keine eigenen vertraglichen Ansprüche gegen den Supermarkt. Es kommt mit etwaigen Pflichtverletzungen des Supermarktes (hier der Verletzung der Pflicht, die Kunden vor Gefahren zu schützen) ebenso in Kontakt, wie die Mutter K. Sofern die Mutter M nun ein erkennbares Einbeziehungsinteresse der K in ihr Vertragsverhältnis mit dem Supermarkt hat, sind die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter gegeben: Sie wird in das Vertragsverhältnis zwischen M und S einbezogen und bekommt damit einen eigenen vertraglichen Schadensersatzanspruch.
Genau an diesem Merkmal, dem Einbeziehungsinteresse, ist auch regelmäßig die Abgrenzung zur Drittschadensliquidation vorzunehmen: Liegt ein Einbeziehungsinteresse (durch Auslegung, §§ 133, 157 BGB, zu ermitteln) vor, erhält K einen eigenen vertraglichen Anspruch, sodass die Drittschadensliquidation ausgeschlossen ist. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Drittschadensliquidation möglich.
Generell gilt, dass der Schädiger bei der Drittschadensliquidation besser steht als in Fällen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter: Seine Haftung wird nämlich lediglich auf eine andere Person verlagert, während der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter einen potenziellen zusätzlichen Gläubiger schafft und so die Haftung des Schädigers erweitert.
Für den Dritten, also die Person, die den eigenen Schaden erlitten hat, ist jedoch der Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter vorteilhafter: Er erhält einen eigenen, direkten Anspruch gegen den Schädiger, ohne von der Mitwirkung des Gläubigers abhängig zu sein.
Fazit zur Drittschadensliquidation
Die Drittschadensliquidation ist ein komplexes Rechtsinstitut, das eine wichtige Rolle spielt, wenn Schaden und Anspruch nicht in der gleichen Person zusammenfallen. Es ermöglicht, dass der erlittene Schaden zur Anspruchsgrundlage gezogen wird, auch wenn der Gläubiger keinen Schaden erlitten hat. Dieses Konzept kann in verschiedenen Situationen relevant sein und erfordert eine genaue Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen und der beteiligten Parteien. Schließlich ist es wichtig, die Drittschadensliquidation vom Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter abzugrenzen, um Missverständnisse zu vermeiden und das Recht korrekt anzuwenden.

Häufig gestellte Fragen rund um die Drittschadensliquidation
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Wo ist die Drittschadensliquidation geregelt?
Die Drittschadensliquidation ist im deutschen Recht geregelt und findet Anwendung in verschiedenen Fallkonstellationen, die im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) spezifiziert sind. Sie ist jedoch nicht in einem speziellen Einzelparagrafen des BGB explizit festgehalten, sondern ergibt sich aus der Gesamtheit der Regelungen und Prinzipien des deutschen Zivilrechts, insbesondere aus den Grundsätzen des Schadensersatzrechts und den allgemeinen Prinzipien des Vertragsrechts. Die genauen Voraussetzungen und Anwendungsfälle der Drittschadensliquidation werden in der juristischen Literatur und Rechtsprechung ausführlich erläutert.
Können Schadensersatzansprüche abgetreten werden?
Ja, Schadensersatzansprüche können im Rahmen der Drittschadensliquidation abgetreten werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Dies ermöglicht, dass der erlittene Schaden zur Anspruchsgrundlage gezogen wird, auch wenn der Gläubiger keinen Schaden erlitten hat. In dem Fall, dass der Gläubiger den Anspruch bereits gegenüber dem Schädiger geltend gemacht hat und dieser schon Schadensersatz gezahlt hat, muss der Gläubiger diesen an den Geschädigten weiterleiten. Falls der Gläubiger den Anspruch bislang nicht gegenüber dem Schädiger geltend gemacht hat, muss er den Anspruch gegen den Schädiger an den Geschädigten abtreten.