- Zivilrecht
- Lesezeit: 04:20 Minuten
Garderobenhaftung: Rechte, Pflichte & "keine Haftung"

- "Für Garderobe keine Haftung" schließt nicht in allen Fällen die Haftung des Veranstalters aus.
- Der generelle Haftungsausschluss durch AGBs ist oft rechtlich nicht haltbar.
- Bei Übernahme der Garderobe durch den Beherbergungswirt entsteht eine Aufbewahrungspflicht.
- Schadensersatz kann bei bezahlter, nicht einsehbarer und überwachter Garderobe beansprucht werden.
- Bei Entgelt für die Garderobe entsteht ein Verwahrungsvertrag, der den Betreiber zur Haftung verpflichtet.
- Kulturbetriebe gehen bei Aufforderung zur Garderobenabgabe einen Verwahrungsvertrag ein.
In vielen Restaurants oder Clubs gehört das Schild mit der Aufschrift „Für Garderobe keine Haftung“ schon zur Grundausstattung. Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass Veranstalter damit im Recht sind. Auch wenn das Schild hängt, müssen die Betreiber in einigen Fällen für verschwundene oder kaputte Kleidung haften. Wer wann für seine Garderobe haftet und bei wem die Pflicht liegt, aufzupassen, erfahren Sie im nachfolgenden Ratgeber.
Was bedeutet Garderobenhaftung?
Grob gesagt, handelt es sich hier um die gesetzliche Haftung eines Gastwirtes für die Garderobe. Dies bedeutet, dass der Beherbergungswirt für eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Ort für seine Gäste die Garderobe bewacht. Der Gast übergibt die Kleidung in die Obhut des Beherbergungswirtes. Sind Sie also Gast in einem Hotel und möchten dort ein Essen einnehmen, so hat der Hotelbetreiber die Aufsichtspflicht gegenüber der Garderobe.
Zwar haftet der Speise- und Schankwirt nicht nach §§ 701ff. BGB, doch er muss bestimmte Verwahrungspflichten von Gütern seiner Gäste beachten. Ein Wirt müsste beispielsweise haften, wenn die Garderobe sich in einem unbewachten Nebenraum befindet und die Bekleidung auch nur dort abgelegt werden darf. Dabei ist es unerheblich, ob das Schild „Für Garderobe keine Haftung“ angebracht ist oder nicht.
Habe ich im Ernstfall ein Recht auf Schadensersatz?
Wenn Sie sich einen schönen Abend in einer Diskothek machen möchten, müssen Sie nicht nur am Eingang anstehen, sondern meistens auch noch vor der Garderobe. Nehmen wir einmal an, die Garderobe befindet sich abseits der Tanzfläche und Sie können sie nicht einsehen. Am Ende des Abends möchten Sie Ihre Jacke wieder abholen, doch dann heißt es plötzlich, dass sie nicht mehr da ist.
Nun haben Sie bestenfalls drei gute Gründe, Schadensersatz von der Diskothek zu verlangen: Sie konnten nämlich von der Tanzfläche aus die Garderobe nicht einsehen, mussten für die Garderobe Geld bezahlen und die Garderobe wurde durchgängig von einem Mitarbeiter überwacht. In dieser Fallkonstellation stehen Ihre Chancen sehr gut, Schadensersatz zu erhalten. Aufgrund der kostenpflichtigen Garderobe ist der Betreiber einen sogenannten Verwahrungsvertrag eingegangen (§ 688 BGB).
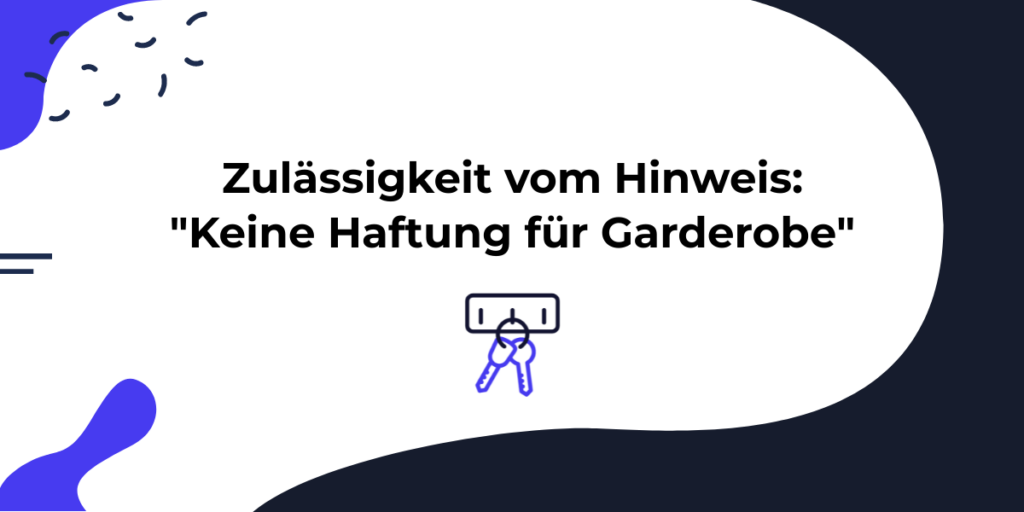
Für Garderobe keine Haftung - stimmt das wirklich?
Sehen Sie in einer Location Hinweisschilder, die eine Garderobenhaftung ausschließen, so handelt es sich um allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gemäß § 305ff. BGB. Was viele nicht wissen, ist, dass solch ein pauschaler Ausschluss oftmals gar nicht zulässig ist. Dann wäre nämlich auch eine Haftung ausgeschlossen, wenn der Betreiber Ihr Kleidungsstück vorsätzlich beschädigt. So etwas ist gemäß § 309 BGB unwirksam.
Ob Sie einen Restaurantbetreiber für Verluste haftbar machen können, hängt immer vom jeweiligen Einzelfall ab. Hängen Sie Ihre Jacke in einem Restaurant freiwillig an jener Garderobe auf, die Sie von Ihrem Platz aus gut einsehen können, haftet der Betreiber tatsächlich nicht. Hierzu müsste noch nicht einmal das Schild „Für Garderobe wird keine Haftung übernommen“ hängen. Denn in diesen Fällen haftet der Gastwirt ohnehin nicht.
Anders sieht es bei zentralen Garderoben aus. Insbesondere dann, wenn Sie dafür ein Entgelt leisten. Dies ist oftmals in Theatern oder auch gehobeneren Restaurants der Fall. Demnach entsteht dann nämlich ein Verwahrungsvertrag. Somit hat auch ein Schild mit der Aufschrift „Für Garderobe keine Haftung“ keine Auswirkungen. Schließlich können Sie als Gast selbst nicht auf Ihre eigene Garderobe achten. Auch die in den Kleidungen befindlichen Gegenstände, wie Schlüssel oder Portemonnaie, sind dann von der Garderobenhaftung eingeschlossen. Durch den Verwahrungsvertrag ist es auch unerheblich, ob die Garderobe bewacht wird oder nicht; der Betreiber haftet bei einem Verlust.
Viele Kulturbetriebe sollten die Obhutspflicht nicht ignorieren
Auch bei einem Museumsbesuch oder in einer Bibliothek kann es einmal vorkommen, dass Sie von dem Service- und Aufsichtspersonal gebeten beziehungsweise aufgefordert werden, Oberbekleidung und/oder große und sperrige Gegenstände abzugeben. Dies dient etwa der Verkehrssicherheit oder dem Schutz von Exponaten. Allerdings kann dies für Kulturbetriebe rechtliche Folgen haben, denn sobald verlangt wird, bestimmte Gegenstände an einem bestimmten Ort abzugeben (und Sie selbst nicht mehr die Aufsicht darüber haben), kommt ebenfalls ein Verwahrungsvertrag gemäß §§ 688ff. BGB zustande. Dieser Vertrag kann entweder stillschweigend oder auch ausdrücklich entstehen. Folgende Merkmale weisen auf einen Verwahrungsvertrag hin:
- Ihre abgelegten Gegenstände sind nicht in Ihrer Sichtweite.
- Sie werden zur Abgabe von Sachen gezwungen.
- Die Garderobe darf nur gegen Entgelt genutzt werden.
- Der Aufbewahrungsraum ist abgetrennt von dem Raum, in dem Sie sich aufhalten und somit keine Einsicht haben.
- Die abgegebenen Sachen werden beaufsichtigt.
Fazit zur Garderobenhaftung
Die Sorgfaltspflichten gegenüber der Garderobenhaftung sollten Veranstalter stets ernst nehmen und für eine adäquate Aufbewahrung sorgen. Gerade dann, wenn Gäste dafür ein Entgelt zahlen. Veranstalter sollten deshalb qualifiziertes Personal einsetzen und zudem ihren Versicherungsschutz überprüfen.
Besucher von Veranstaltungen wiederum sollten bei der Abgabe Ihrer Garderobe darauf achten, dass diese ordnungsgemäß und sicher verwahrt und die Obhutspflicht eingehalten wird. Oftmals haben Sie dann im Ernstfall einen Anspruch gegen den Veranstalter. Sollte es tatsächlich einmal zu einem Verlust kommen, empfiehlt sich jedoch eine individuelle rechtliche Beratung, um die Haftungsfrage persönlich zu klären.

Häufig gestellte Fragen rund um die Garderobenhaftung
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was bedeutet Garderobenpflicht?
Besteht Garderobenpflicht, dürfen Sie keine größeren Gegenstände oder Jacken mit in einen Saal nehmen. Sie sind verpflichtet, diese vorher an einer zentralen Garderobe zur Aufbewahrung abzugeben.
Was ist mit dem Begriff „Garderobe“ genau gemeint?
Garderobe bedeutet konkret die gesamte Oberbekleidung, die eine Person trägt, beziehungsweise mit sich führt.
Ist die Garderobenhaftung gesetzlich geregelt?
Grundsätzlich haftet der Betreiber bei Beschädigung oder Verlust der Garderobe eines Gastes. Gesetzlich geregelt ist dies in § 701 BGB.