- Mietrecht
- Lesezeit: 7:00 Minuten
Äste des Nachbarn: Rechte, Beseitigungsanspruch & Muster
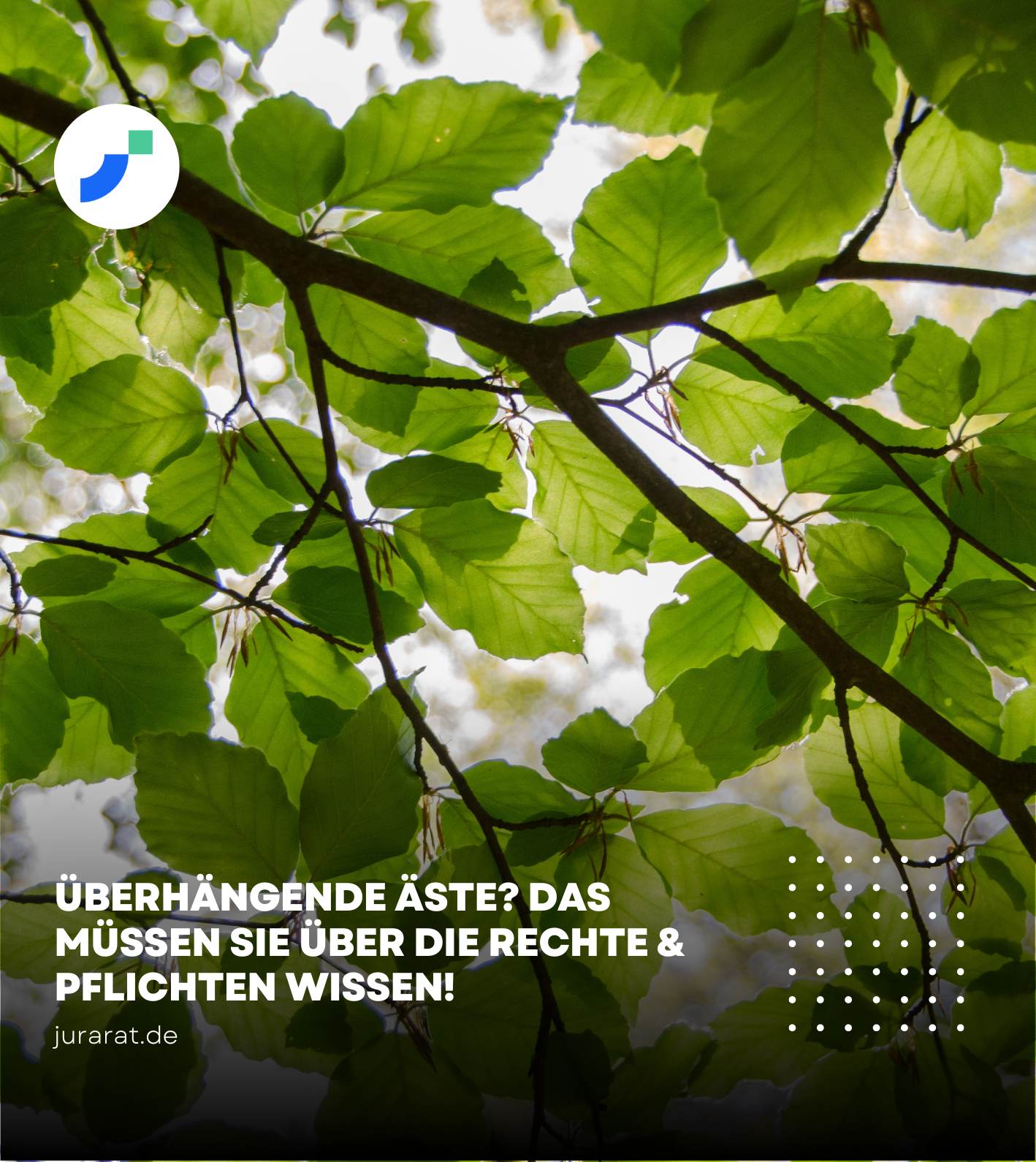
- § 910 und § 1004 BGB regeln den Umgang mit überhängenden Ästen und Wurzeln.
- Eine Beseitigung des Überhangs ist nur bei tatsächlicher Beeinträchtigung des eigenen Grundstücks erlaubt.
- Falls der Nachbar den Überhang nicht fristgerecht entfernt, darf man selbst oder ein Fachmann die Äste abschneiden.
- Baumschutzverordnungen und Bundesnaturschutzgesetze setzen weitere Grenzen für das Fällen oder Beschneiden von Bäumen.
Wenn die Baumzweige des Nachbarn über die Grundstücksgrenze wachsen, können Schattenwurf und herabfallendes Laub die Benutzung des eigenen Grundstückes stören. Zuerst sollte das Gespräch mit dem Baumbesitzer gesucht werden, aber nicht immer gelingt eine außergerichtliche Einigung.
Woraus ergibt sich ein Anspruch auf die Beseitigung des Überhangs?
§ 910 und § 1004 BGB bilden die Grundlage für den Umgang mit herüber gewachsenen Wurzeln und Zweigen von Bäumen und Sträuchern:
Aus dem ersten Absatz des § 910 BGB "Überhang" geht hervor, dass der Nachbar zum Abschneiden der überhängenden Äste aufgefordert und ihm eine angemessene Frist gesetzt werden kann: "Der Eigentümer eines Grundstückes kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt (§ 910 BGB, Abs. 1)."
Erfolgt der Rückschnitt nicht innerhalb der Frist, darf man selbst abschneiden bzw. durch einen Fachmann abschneiden lassen und dies dem Nachbarn in Rechnung stellen (vgl. §§ 812, 910, 1004 BGB). Allerdings muss der Überhang fachgerecht und nur bis zur Grundstücksgrenze entfernt werden, sonst kann der Baumbesitzer Schadensersatz verlangen.
Es muss eine Beeinträchtigung vorliegen
Voraussetzung, dass überhaupt ein Überhang beseitigt werden kann, ist, wenn dieser die Benutzung des eigenen Grundstückes beeinträchtigt: "Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln oder die Zweige die Benutzung des Grundstückes nicht beeinträchtigen (§ 910 BGB, Abs. 2)".
„Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen (...)“ (§ 1004 BGB, Abs. 1).
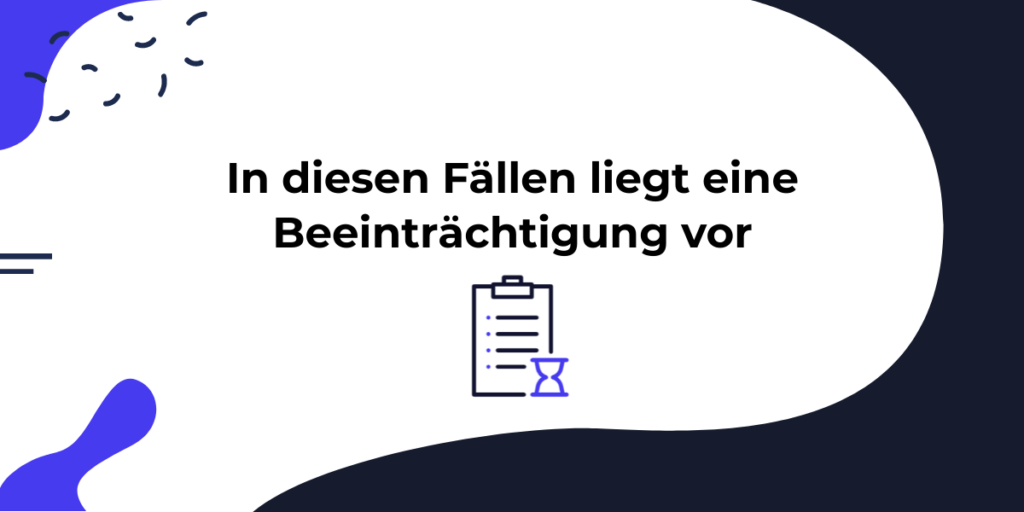
Wann liegt eine Beeinträchtigung vor?
Nicht in jedem Fall ist es eindeutig, ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht. Meist wird dazu ein Sachverständiger eingeschaltet. Geringfügige Beeinträchtigungen sind zum Beispiel herüber ragende Äste in großer Höhe, auch wenn sie Laub auf das betroffene Grundstück werfen (vgl. Amtsgericht Norden, 11.04.2003, 5 C 884/01 und AG Wiesbaden, 14.03.1990, 96 C 1504/89, NJW-RR 1991, 405). Da Laubabwurf, Samenflug und sonstige natürliche Emissionen eines Baumes in der Natur der Sache liegen, müssen diese geduldet und auf eigene Kosten entfernt werden.
Anders verhält es sich, wenn Laub auf das Dach fällt und den Abfluss von Regenwasser nachweislich beeinträchtigt: in einem solchen Fall wurden die Beklagten dazu verurteilt, die überhängenden Äste zu entfernen (vgl. LG Köln, 13.06.2010, 27 O 239/09). In einem ähnlichen Fall wurde jedoch entschieden, dass die Beeinträchtigung durch die Nadeln zweier überhängender Kiefern geringfügig sei (vgl. BGH, 14.11.2003 - V ZR 102/03 - LG Stade, AG Cuxhaven). Hier kommt es sicherlich auch auf die Größe, Beschaffenheit und die Zweckbestimmung des betroffenen Grundstücks an.
Beispiele für geringfügige Beeinträchtigungen
Starker Laubabwurf wird in der Regel als geringfügige Beeinträchtigung eingestuft und begründet nicht das Abschneiden der überhängenden Äste oder gar das Fällen des Baumes. Eine solche natürliche Emission ist zu dulden. Laut § 906 BGB kann aber ein Ausgleich in Geld gefordert werden: „Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt" (§ 906 BGB).
Wie sieht es in der Praxis aus?
In der Praxis entscheiden Gerichte aber immer häufiger zugunsten der Baumbesitzer und die Klagen werden abgewiesen: „Ein Durchschnittsbenutzer des betroffenen Grundstücks wird aufgrund dieser grundsätzlichen Überlegung den Arbeitsaufwand für die Entfernung des von herüberhängenden Zweigen und Ästen herabfallenden Laubes und durch den Lauf der Natur bedingten Blüten- und Samenteile hinnehmen, ohne für die geleistete Arbeit einen Geldausgleich vom Nachbarn zu verlangen" (LG Stuttgart, 28.05.1980, 13 S 15/80).
Welche Bäume dürfen erst gar nicht gefällt werden?
Es gibt für Gemeinden und Städte Baumschutzverordnungen, in denen definiert wird, wann ein Baum geschützt ist, zum Beispiel, wenn ein bestimmter Stammumfang gegeben ist. Die Verordnungen können online oder auf Nachfrage beim zuständigen Grünflächenamt bzw. bei der unteren Naturschutzbehörde erhalten werden. Geschützte Bäume dürfen in ihrem Aufbau nicht wesentlich verändert werden, es sei denn, sie gefährden Personen oder Sachen. Hier sind die regionalen Unterschiede zu beachten. Der konkrete Fall sollte durch die Gemeinde geprüft werden lassen. Bäume in speziellen Biotopen stehen auch unter Schutz. Das ist in den Naturschutzgesetzen der Bundesländer geregelt.
Welcher Abstand beim Einpflanzen von Bäumen ist einzuhalten?
In den Nachbargesetzen der Bundesländer ist der Abstand festgelegt, den ein Baum zum Nachbargrundstück haben muss. Werden die Abstände unterschritten, kann die Beseitigung oder der Rückschnitt gefordert werden, auch wenn keine Beeinträchtigung von dem Baum ausgeht. Ausgenommen sind geschützte Bäume (siehe Baumschutzverordnung oder Naturschutzgesetze).
Die Mindestabstände können bei der Gemeinde erfahren werden. Bis zu einer Wuchshöhe von zwei Metern sollte ungefähr 50 Zentimeter Abstand einhalten werden; bei Gewächsen, die größer werden, gelten meistens zwei Meter Mindestabstand. Des Weiteren haben einige Bundesländer festgelegt, dass von März bis September Bäume nicht verschnitten werden dürfen (Bundesnaturschutzgesetz).
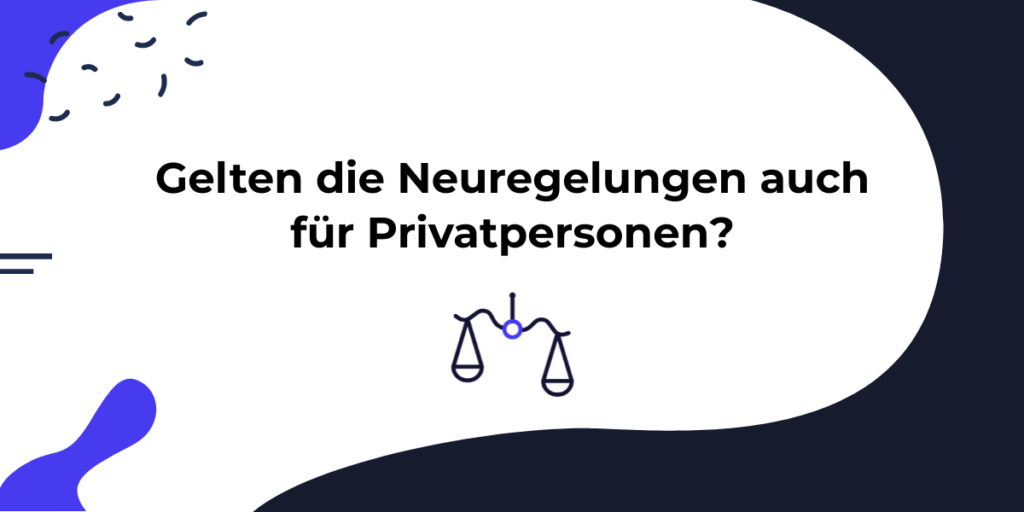
Neuregelung in den Bundesnaturschutzgesetzen - gelten diese auch für Private?
Seit 2010 gibt es eine Neuregelung im Bundesnaturschutzgesetz, die besagt, dass unabhängig von den Nachbarrechtsgesetzen der Bundesländer nun bundesweit ein Schnittverbot vom 01.03. bis 30.09. des Jahres gilt: in dieser Phase ist es verboten, Bäume, die „außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzter Grünflächen stehen (…) vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden“ (§ 39 BNatSchG).
Weiterhin wurde festgelegt, dass Bäume in privaten Gärten und Grünanlagen davon aber ausgenommen sind, da es sich um gärtnerisch genutzte Grünflächen handelt. Für Grundstücksbesitzer gelten also weiterhin die in den Nachbargesetzen genannten Zeiten zum Schnittverbot. Ist der Baum allerdings zur Lebensstätte wild lebender Tiere geworden, darf er zu keiner Zeit gefällt oder zurückgeschnitten werden. Die Fällung könnte dennoch bei der zuständigen Naturschutzbehörde beantragt werden, was meistens erfolglos bleibt.
Was ist, wenn ein Baum zu nah am Nachbargrundstück gepflanzt wurde?
Neben den Baumschutzverordnungen, dem Naturschutzgesetz und den jahreszeitlichen Einschränkungen sind Fristen zu beachten, innerhalb derer eine Forderung zum Rückschnitt bzw. zur Beseitigung des zu nah an der Grenze befindlichen Baumes möglich ist. Hier gelten in den Bundesländern unterschiedliche Zeiträume, oft gilt eine Frist von fünf Jahren nach Anpflanzung. Wer innerhalb dieser Frist den Rückschnitt oder die Entfernung nicht fordert, muss den Baum und dessen Überhang zukünftig dulden, es sei denn, von dem Überhang geht, wie oben erläutert, eine Beeinträchtigung aus (vgl. §§ 910, 1004 BGB).
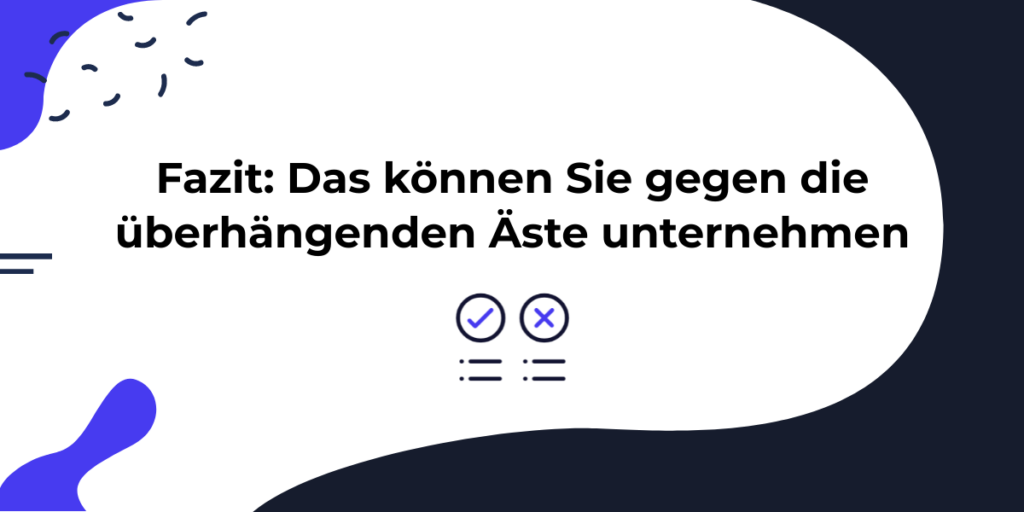
Fazit zum Thema überhängende Äste vom Nachbarn
Das deutsche Recht bietet klare Richtlinien für den Umgang mit überhängenden Ästen des Nachbarn. Während § 910 und § 1004 BGB die rechtliche Grundlage bilden, spielen auch individuelle Beeinträchtigungen und lokale Baumschutzverordnungen eine Rolle. Es ist ratsam, zuerst das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. In jedem Fall sollte man sich der lokalen und bundesweiten Regelungen bewusst sein, um unnötige Konflikte zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Wie weit dürfen Äste auf das Nachbarsgrundstück ragen?
Die Äste dürfen grundsätzlich nicht so weit auf das Nachbargrundstück ragen, dass sie eine Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung verursachen. Was als Beeinträchtigung gilt, kann jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich sein und wird oft durch Sachverständige oder Gerichte beurteilt.
Wer muss Überwuchs entfernen?
Der Eigentümer des Baumes ist in der Regel für den Überwuchs verantwortlich. Wenn er nach einer angemessenen Frist (2-4 Wochen) den Überhang nicht entfernt hat, darf der betroffene Nachbar die Äste selbst oder durch einen Fachmann abschneiden.
Kann mich mein Nachbar zwingen, den Baum zu fällen?
Nein, ein Nachbar kann Sie in der Regel nicht dazu zwingen, den Baum komplett zu fällen, es sei denn, der Baum stellt eine unmittelbare Gefahr dar oder verstößt gegen lokale Baumschutzverordnungen. In den meisten Fällen beschränkt sich das Recht auf das Abschneiden überhängender Äste.
Was kann man gegen die überhängende Äste des Nachbars tun?
Zuerst sollte das Gespräch mit dem Nachbarn gesucht werden. Wenn keine Einigung erzielt wird, kann man sich auf § 910 BGB berufen und den Nachbarn auffordern, den Überhang innerhalb einer angemessenen Frist zu entfernen. Erfolgt dies nicht, darf man die Äste selbst abschneiden oder durch einen Fachmann abschneiden lassen.
Wer muss die Äste vom Nachbarn entsorgen?
Nach § 910 BGB hat der Grundstückseigentümer das Recht, die abgeschnittenen Äste zu behalten. Das bedeutet, dass die Entsorgung der Äste in der Verantwortung des Grundstückseigentümers liegt, der den Schnitt veranlasst hat.