- Zivilrecht
- Lesezeit: 10:35 Minuten
Schadensersatz: Definition, Ansprüche & Höhe berechnen

- Schadenersatz dient als Ausgleich für Schäden und kann aus Verträgen oder Delikten resultieren.
- Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) regelt die allgemeinen Grundsätze und spezifischen Paragraphen für Schadenersatz.
- Verschiedene Schadensarten wie Personenschäden, Vermögensschäden und Sachschäden sind abgedeckt.
- Verschulden und kausaler Zusammenhang sind entscheidend für die Haftung.
- Das deutsche Recht folgt dem Prinzip der Totalrestitution, es gibt jedoch keine Strafen für den Schädiger wie im US-Recht.
Es ist schon ärgerlich genug, wenn ein Schaden zustande gekommen ist. Als Geschädigter ist es von Interesse möglichst schnell und möglichst umfassend eine Bestandsaufnahme über den eingetretenen Schaden zu machen, um anschließend Schadensersatzforderungen durchsetzen zu können. Wie der Schadensersatz korrekt ermittelt wird und was es dabei zu beachten gibt, erfahren Sie hier.
Was bedeutet Schadensersatz?
Als Schadenersatz wird ein Ausgleichsinteresse bezeichnet, das der geschädigten Partei durch die ersatzpflichtige Gegenseite in Person des Schädigers zusteht. Diese Parteien können natürliche oder juristische Personen sein. Schadenersatzansprüche resultieren häufig aus gegenseitigen Verträgen (z. B. Kaufvertrag, § 433 BGB), bei denen eine Vertragsverletzung durch eine der Parteien vorliegt. Es liegt ein sekundärer Schadenersatzanspruch aufgrund einer Sonderverbindung zwischen den Parteien in Form des Vertrages vor. Der Anspruch auf Schadenersatz kann sich auch außerhalb vertraglicher Beziehungen hinsichtlich der Gefährdungshaftung und unerlaubter Handlung ergeben. Diese Ansprüche aus dem Deliktsrecht sind primär und entstehen automatisch in dem Moment, in dem die unerlaubte Handlung eintritt. Dem Geschädigten steht ein Primäranspruch per Gesetz ohne Sonderverbindung zu.
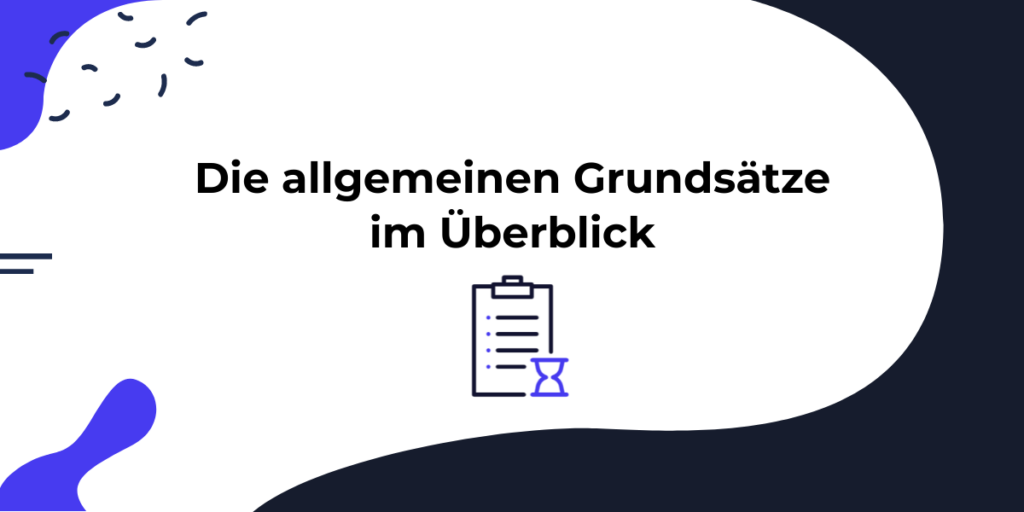
Welche allgemeinen Grundsätze bestehen?
Der Anspruch auf Schadenersatz ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Die allgemeinen Grundsätze sind in den §§ 249 bis 255 niedergeschrieben. Die Partei, die sich einer schädigenden Handlung schuldig gemacht hat, muss den Zustand wieder herstellen, der bestehen würde, wäre das schädigende Ereignis nicht eingetreten (§ 249).
Liefert A dem B einen Wohnzimmerschrank und beschädigt dabei versehentlich das Klavier, hat A gegenüber dem B einen Anspruch auf Schadenersatz, allerdings nicht aus dem Vertragsverhältnis (primärer Anspruch), sondern aufgrund einer unerlaubten Handlung (sekundärer Anspruch). Lieferant B hat nicht seine Verpflichtungen aus dem Liefervertrag verletzt, sondern unerlaubt das Klavier des Kunden A beschädigt. B muss durch Reparaturmaßnahmen den Zustand vor dem Schaden wieder herstellen. Besonderheiten sind der Schaden aufgrund eines entgangenen Gewinns (§ 252 BGB), eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, z. B. Schmerzensgeld (§ 253 BGB), und Mitverschulden des Geschädigten (§ 254 BGB), der zur Schadensteilung führt und unter Umständen den Wegfall des Schadenersatzanspruches nach sich zieht.
Durch den Eintritt des schädigenden Ereignisses tritt eine Verschlechterung des betroffenen Rechtsgutes ein. Die geschädigte Partei ist so zu stellen wie vor Eintritt des Ereignisses (§ 251 BGB). Der Schaden kann materiell oder immateriell begründet sein. Der Zustand und der Wert des geschädigten Rechtsgutes vor Eintritt des Schadens werden mit dem Zustand und Wert nach Eintritt des Schadens verglichen. Die sich daraus ergebende Differenz ist der Schaden, aufgrund dessen die geschädigte Partei ihre Ansprüche gegen den Schädiger geltend machen kann.
Die Rechtswissenschaft unterscheidet zwischen Personenschäden, Vermögensschäden, Sachschäden und Streuschäden. Welche Ausgleichsansprüche der geschädigten Partei im Einzelfall zustehen, bestimmt das Schadenersatzrecht. Der Anspruchsteller muss beweisen, dass der Schaden tatsächlich durch das schädigende Ereignis und nicht aus einem anderen Grund eingetreten ist. Zwischen dem Schaden und dem schädigenden Ereignis muss also ein kausaler Zusammenhang bestehen.
Was bedeutet das Deliktsrecht?
Die gesetzlichen Schadenersatzansprüche sind in den §§ 823 bis 853 BGB geregelt. Das Deliktsrecht gemäß § 823 BGB stellt die bedeutendste Rechtsnorm der zivilen Rechtsprechung dar. Verletzt jemand fahrlässig, vorsätzlich oder widerrechtlich das Leben, die Gesundheit, das Leben, den Körper, die Freiheit, das Eigentum oder sonstige Rechte eines anderen, ist er verpflichtet, für den aus diesem Ereignis resultierenden Schaden aufzukommen. Es handelt sich dabei um die absoluten Persönlichkeitsrechte und Rahmenrechte (Besitz, Immaterialgüter, Familienrechte).
Die Schadenersatzpflicht trifft denjenigen, der ein Gesetz verletzt, das einen anderen schützen soll. In diesen Rechtsbereich gehören auch die Regelungen des Strafgesetzbuches und zahlreicher weiterer Gesetze aufgrund von Sachbeschädigung, Tötungsdelikten oder Körperverletzung (§§ 280, 823 BGB, §§ 303, 223, 224, 211, 20, 21 StGB). Entsprechend § 826 BGB wird auch die vorsätzliche oder sittenwidrige Schädigung geahndet. Ersatzfähig ist der reine Vermögensschaden.
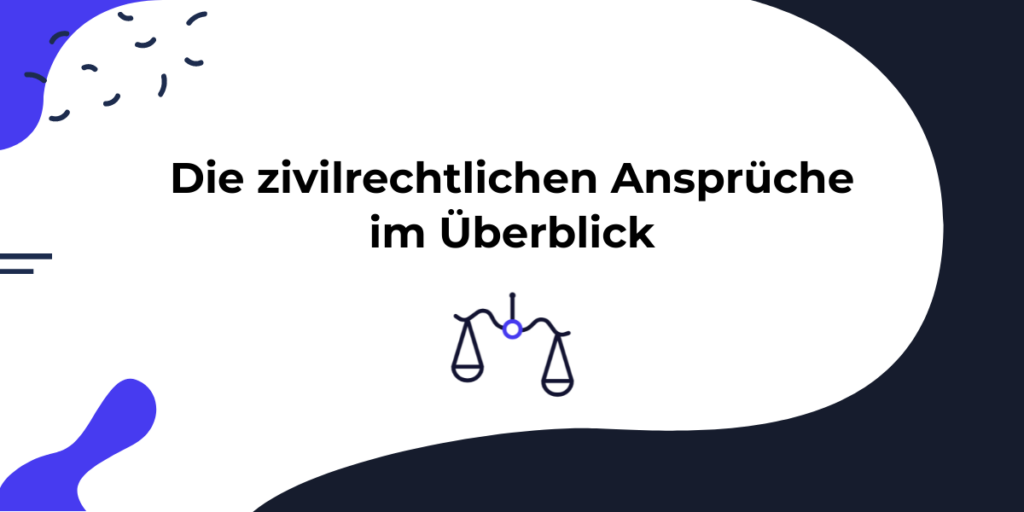
Was sind zivilrechtliche Schadensersatzansprüche?
Vertragliche Schadenersatzansprüche entstehen, wenn eine Partei ihren Haupt- oder Nebenverpflichtungen aus einem gegenseitigen Vertrag nicht oder nur ungenügend nachkommt. Verletzt eine der Vertragsparteien ihre Pflichten aus dem Vertragsverhältnis, so entsteht unter Umständen der Anspruch auf Schadenersatz, entweder neben der Leistung oder anstelle der Leistung. Dieses Schuldrecht ist in § 280 BGB geregelt. Die Pflichtverletzung kann zum Beispiel in einer mangelhaften Lieferung bestehen oder einer verletzten Nebenpflicht aus §§ 241, 324 BGB. Diese bestehen in Schutzpflichten und Aufklärungspflichten.
Sie regeln die Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter anderer (Eigentum, Gesundheit, Leben etc.) und die Aufklärungspflichten über genaue Vertragsgegebenheiten. Nach der Modernisierung des Schuldrechts wurde der Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung in Schadenersatz wegen Nichterfüllung umbenannt. Erbringt der Schuldner die Leistung nicht oder nicht wie vereinbart (Nicht- oder Schlechtleistung §§ 323, 434 BGB), kommt ein Schadenersatzanspruch entsprechend der §§ 281, 282, 283 i. V. m. § 280 BGB anstatt der geschuldeten Leistung in Form eines finanziellen Ausgleichs in Betracht (Rücktritt vom Vertrag, §§ 346, 323, 437 BGB). Aufgrund des festgestellten positiven Interesses (§ 249 BGB) ist der Gläubiger so zu stellen, als wäre der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden.
Besteht bei Lieferverzug oder anderem Verzögerungsschaden auch ein Anspruch?
Anspruch auf Schadenersatz neben der Leistung besteht zum Beispiel bei Lieferverzug oder einem Verzögerungsschaden (§§ 280, 286, 271 BGB). Hat der Gläubiger im Fall eines Verzuges dennoch Interesse an der vertraglich vereinbarten Leistung nach entsprechender Fristsetzung (Beseitigung des Rechtsmangels § 439 BGB), kann er neben der Leistung Anspruch auf Schadenersatz entsprechend §§ 280, 286, BGB erheben.
Der geschädigten Partei kann auch ein Mitverschulden am Eintritt des unerwünschten Ereignisses treffen, das gemäß § 254 BGB zum Wegfall des Anspruchs führen kann. Ein Mitverschulden tritt immer dann ein, wenn die geschädigte Partei durch ihr Verhalten, grobe Fahrlässigkeit oder das Außerachtlassen der üblichen Sorgfaltspflichten das schädigende Ereignis herbeigeführt hat.
Ansprüche auf Schadenersatz treten ausschließlich bei materiellen Gütern ein, im Fall immaterieller Güter wie Verletzung der Freiheit, des Körpers oder der Gesundheit ist die geschädigte Partei berechtigt, Schmerzensgeld zu fordern. Weitere Schadensersatzansprüche ergeben sich aus Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung in Form der verschuldensunabhängigen Gefährdungshaftung des Fahrzeughalters, die gemäß § 7 Straßenverkehrsgesetz geregelt ist.
Der Fahrzeughalter kann sich jedoch exkulpieren, wenn er beweisen kann, dass er den Schaden weder vorsätzlich noch fahrlässig herbeigeführt hat. §§ 844 bis 846 BGB befassen sich mit Schadenersatzansprüchen aufgrund einer Dritthaftung. So trifft zum Beispiel einen unmittelbar Hinterbliebenen und Erben eines verstorbenen Unterhaltungspflichtigen die Schadensersatzpflicht gegenüber der geschädigten Partei.
Beide Verschuldensarten, die primäre Haftpflicht per Gesetz als auch die sekundäre Haftpflicht aufgrund von Sonderverbindungen aus gegenseitigen Verträgen setzt regelmäßig ein Verschulden und einen kausalen Zusammenhang zwischen dem geschädigten Rechtsgut und dem schädigenden Ergebnis voraus.
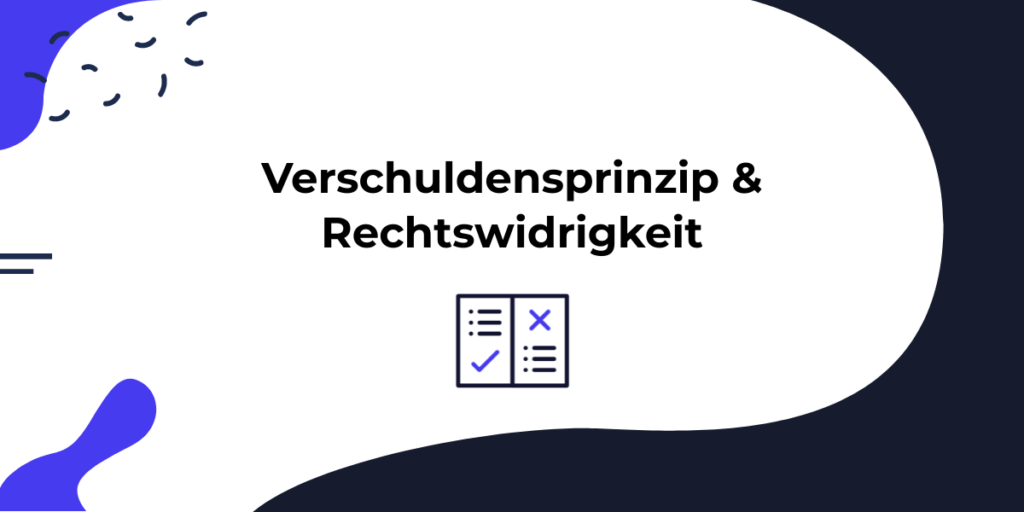
Was besagt das Verschuldensprinzip?
§ 276 BGB definiert Verschulden als Fahrlässigkeit (außer Acht lassen der verkehrsüblichen Sorgfaltspflicht) oder Vorsatz (der Schaden wird gewollt herbeigeführt). Grundsätzlich entstehen Schadensersatzansprüche nur gegenüber Personen, die den Schaden schuldhaft selbst herbeigeführt haben. Dieser Rechtsgrundsatz wird jedoch mehrfach unterbrochen, zum Beispiel hinsichtlich der Haftung für Fremdverschulden oder der Gefährdungshaftung für aufsichtspflichtige Personen (§§ 832, 1631 BGB). Bedient sich der Auftraggeber der Arbeit eines Gehilfen und verursacht dieser einen Schaden, muss er sich dieses Fremdverschulden so zuschreiben lassen, als hätte er den Schaden selbst verursacht.
Aufsichtspflichtige Personen sind insbesondere Kinder, wobei sich die Haftungspflicht der Eltern je nach Alter und Reife der Kinder ausweitet oder vermindert. Kinder unterstehen einer generellen Aufsichtspflicht der Eltern. Ob Eltern für das schädigende Verhalten ihrer Kinder haften, hängt davon ab, ob sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben oder nicht. Kinder unter sieben Jahren sind nicht delikt- und haftpflichtfähig. Haben die Erziehungsberechtigten ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt, haften auch die Eltern nicht. Ab sieben Jahren sind Kinder delikt- und haftpflichtig (§ 828 BGB, verschiedene Altersstufen), ihre Eltern trifft damit bei Verletzung ihrer Aussichtspflicht eine generelle Gefährdungshaftung.
Welche Rolle spielt die Rechtswidrigkeit?
Der Schädiger muss die schädigende Tat rechtswidrig begangen haben. Rechtswidrig handelt ein Schädiger dann, wenn sein Verhalten im Widerspruch zu den festgesetzten Verhaltensregeln der Rechtsordnung steht. Das Zivilrecht sieht die Rechtswidrigkeit im positiven Tun des Schädigers, das zu der Rechtsgutverletzung führt. In Schadensfällen mit komplizierter Grundkonstellation wie bei Verletzung eines Urheber- oder Persönlichkeitsrechts muss die Rechtswidrigkeit ausnahmsweise festgestellt werden. Der Tatbestand der Notwehr (§ 227 BGB) lässt die Schadenersatzansprüche der geschädigten Partei entfallen. Setzt sich jemand gegen den Angriff eines anderen zur Wehr, um Schäden am eigenen Leben, Körper und Gesundheit abzuwehren oder zu vermindern, liegt kein rechtswidriger Tatbestand vor und der Angreifer selbst kann keinen Anspruch auf Schadenersatz stellen.
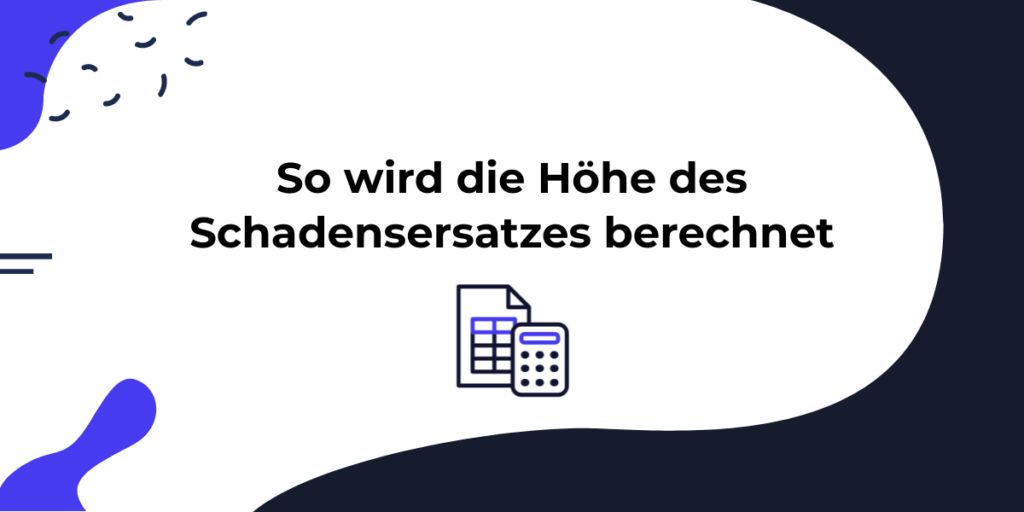
Wie wird die Höhe des Schadensersatzes berechnet?
Die Höhe des Schadensersatzes wird in der Regel durch den tatsächlich entstandenen Schaden bestimmt. Im Falle von materiellem Schaden können das Reparaturkosten oder der Wertverlust einer Sache sein. Bei immateriellen Schäden wie Schmerzensgeld gibt es keine feste Berechnungsformel; hier werden vergleichbare Fälle und die Umstände des Einzelfalls herangezogen.
Was besagt das Prinzip der Totalrestitution?
Das deutsche Schadenersatzrecht geht vom Prinzip der Totalrestitution aus, das heißt, der Geschädigte soll seinen gesamten Schaden ersetzt bekommen. Die Verschuldens- und Gefährdungshaftung sieht keine Obergrenze vor. Zudem wendet das Recht das Prinzip der Naturalrestitution an. Der Schaden liegt in dem Unterschied des tatsächlichen Zustandes des verletzten Rechtsgutes nach Eintritt des Ereignisses und dem Zustand, der ohne das Schadensereignis bestehen würde. Wurde eine Sache oder ein absolutes Recht wie Leben oder Gesundheit beschädigt, sind die Instandsetzungskosten beziehungsweise Heilungskosten zu ersetzen. Hier wird nicht der ursprüngliche Zustand des geschädigten Rechtsgutes (Status quo ante) hergestellt, sondern der hypothetische Zustand ohne Schädigung. Diese Wiederherstellung kann auch bei Vermögensschäden verlangt werden.
Ist eine Bestrafung des Schädigers möglich?
Anders als das US-Recht sieht das deutsche Recht keine Strafe für den Schädiger vor, denn mit diesem Rechtsgrundsatz ist es in Amerika üblich, Schadenersatzsummen in Millionenhöhe einzuklagen, die zu dem eigentlichen Schaden in keinem Verhältnis mehr stehen. Deutschen Anspruchstellern steht nur der Ausgleich des Nachteils zu, den sie durch den Eintritt des schädigenden Ereignisses tatsächlich erlitten haben. Statt der Herstellung der Naturalsituation hat der Geschädigte auch das Recht, für den ihm entstandenen Schaden Ersatz in Form von Geld zu fordern (§ 249 BGB).
Hier wird der Verkehrswert des geschädigten Rechtsgutes herangezogen. Als Schadensersatzkompensation kann auch der Ersatz durch eine gleichwertige Sache (Surrogatanspruch, § 285 BGB) erfolgen. Grundlage für die Berechnung ist der Wiederbeschaffungswert. Nicht erstattungsfähig ist hingegen der Neuwert der Sache, wenn sie schon einige Jahre alt ist. Allerdings muss der Geschädigte sich auch nicht mit dem bloßen Zeitwert (Wert nach Abschreibung) des Rechtsgutes zufriedengeben.
Ist die Herstellung des Zustandes, der ohne den Schadenseintritt bestehen würde, nicht mehr möglich (z. B. Untergang der Sache, § 311 BGB, verschiedene Arten der Unmöglichkeit, § 275 BGB) oder unzumutbar (§ 275 BGB), weil der Aufwand für den Schädiger in keinem Verhältnis, zu dem angerichteten Schaden steht, tritt anstelle der Naturalkompensation die Schadenskompensation in finanzieller Form. Ein Schuldner haftet nicht für Schadenersatz, wenn er den Leistungsmangel (Rechtsmängel - § 435, Sachmangel - § 434 BGB) bei Vertragsabschluss nicht kannte oder seine Unkenntnis nicht zu vertreten hat (§ 275 BGB). Den gleichen Anspruch hat der Geschädigte, wenn der Schädiger seiner Verpflichtung aus diesem Schuldverhältnis nicht fristgerecht nachkommt. Die Schadlosstellung ist grundsätzlich auf Vermögensschäden beschränkt (§ 253 BGB).
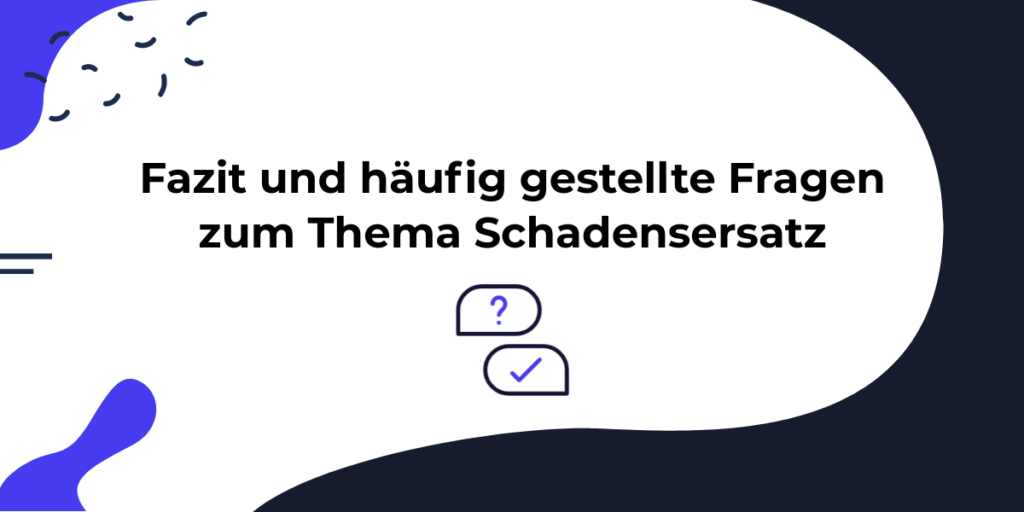
Fazit zum Thema Schadensersatz berechnen
Im Lichte der dargelegten Informationen wird deutlich, dass das Schadenersatzrecht in Deutschland eine komplexe, aber gut strukturierte Materie ist. Es bietet einen rechtlichen Rahmen, der sowohl aus vertraglichen als auch aus deliktischen Beziehungen resultierende Ansprüche abdeckt. Das Prinzip der Totalrestitution steht im Vordergrund, wobei der Geschädigte in den Zustand versetzt werden soll, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde. Im Gegensatz zum US-Recht, das Strafen für den Schädiger vorsieht, konzentriert sich das deutsche Recht ausschließlich auf den Ausgleich des tatsächlich erlittenen Schadens. Verschulden und kausaler Zusammenhang sind dabei entscheidende Faktoren, die den Anspruch auf Schadenersatz begründen oder verneinen können.

Häufig gestellte Fragen
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was sind die Voraussetzungen für einen Schadensersatz?
Die klassischen Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch nach § 823 BGB sind:
Wie kann ich Schadensersatz fordern?
Sie können Schadensersatz schriftlich oder mündlich fordern, wobei die schriftliche Form zu Beweiszwecken empfohlen wird. In vielen Fällen wird die Sache gerichtlich geklärt, insbesondere wenn der Schädiger die Forderung nicht anerkennt.
Wie hoch darf man Schadensersatz verlangen?
Die Höhe des Schadensersatzes orientiert sich am tatsächlich entstandenen Schaden. In manchen Fällen, etwa bei Vertragsbrüchen, kann der Schadensersatz auch im Voraus vertraglich festgelegt sein (sog. “Vertragsstrafe”).
Ist Schmerzensgeld gleich Schadensersatz?
Schmerzensgeld ist eine Form des Schadensersatzes, aber es ist nicht dasselbe. Während Schadensersatz primär darauf abzielt, einen materiellen Schaden auszugleichen, dient Schmerzensgeld dem Ausgleich immaterieller Schäden, z.B. physische oder psychische Leiden.
Welche Schadensersatzansprüche gibt es?
Es gibt unterschiedliche Arten von Schadensersatzansprüchen, darunter: