- Arbeitsrecht
- Lesezeit: 08:03 Minuten
Arbeitgeber zahlt Lohn nicht: Pflichten, Regeln & Lohnklage
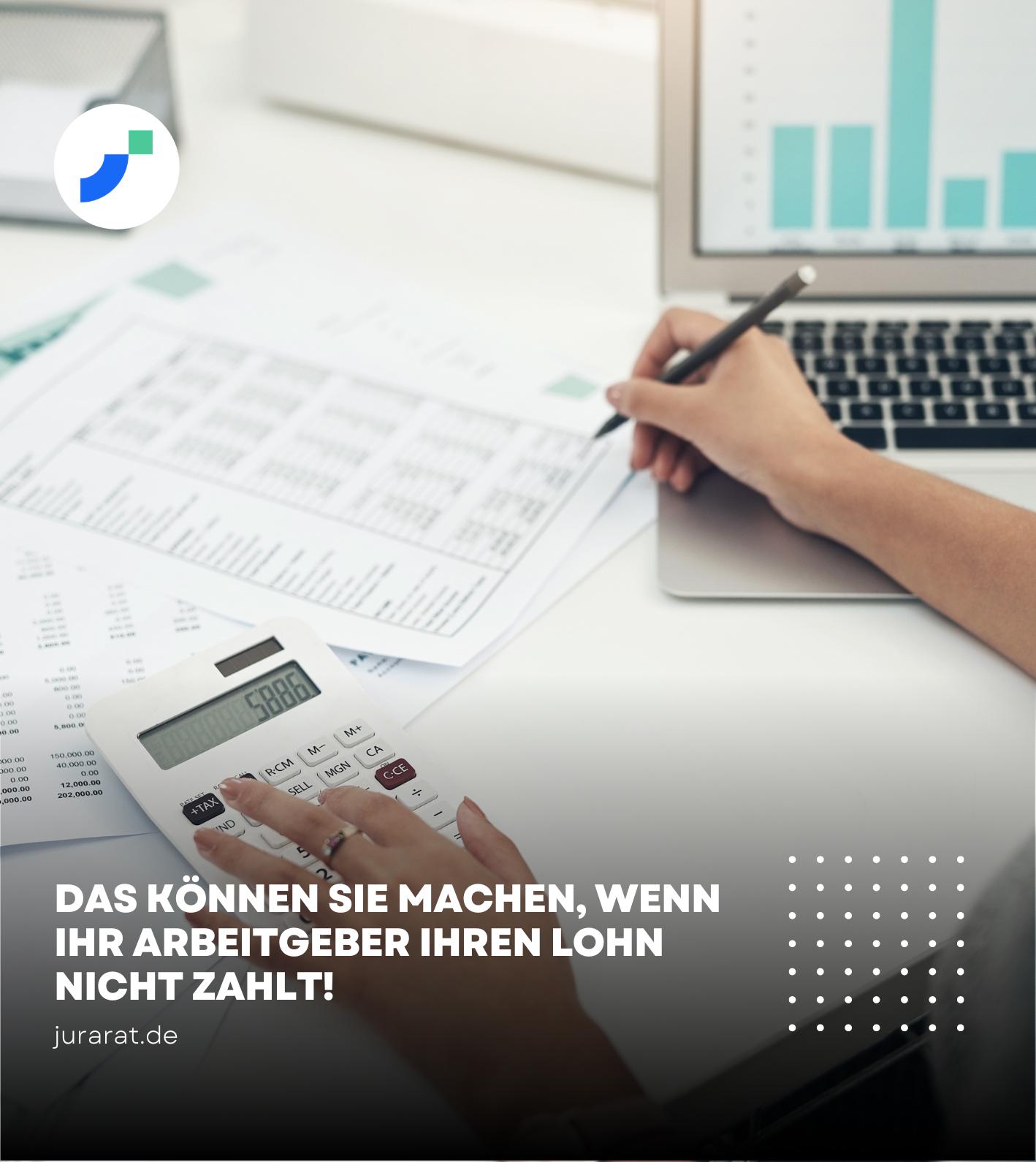
- Bei Ausbleiben des Gehalts stehen Arbeitnehmern verschiedene Mittel zur Eintreibung zur Verfügung.
- Unter Umständen können Arbeitnehmer auch fristlos kündigen.
- In bestimmten Fällen erhalten Sie Arbeitslosengeld von der Arbeitsagentur.
- Das Gehalt ist im Regelfall am Ende eines Monats zu zahlen.
- Letzter Weg zur Einforderung des Gehalts: Klage vor dem Arbeitsgericht.
Ihr Arbeitgeber ist Ihnen gegenüber in der Pflicht, rechtzeitig das Ihnen geschuldete Gehalt zu zahlen. Normalerweise ist die Zahlung vom Arbeitslohn immer am Ende des Monats fällig. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass spätestens am ersten Tag des Folgemonats das Gehalt bei Ihnen auf dem Konto sein muss. Es gibt aber auch Abweichungen, die sich im Regelfall aus Arbeits- oder Tarifverträgen ergeben können. Welche das sind und was Sie unternehmen können, wenn Ihr Lohn ausbleibt, erfahren Sie im nachfolgenden Ratgeber zum Thema: Was tun, wenn der Arbeitgeber nicht zahlt?
Was kann ich machen, wenn der Arbeitgeber meinen Lohn nicht zahlt?
Sollte Ihr Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachkommen, Ihnen rechtzeitig Ihren Lohn zu zahlen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:
- Sie können Ihren Arbeitgeber abmahnen.
- Fordern Sie Ihren Arbeitgeber – schriftlich oder mündlich – zur Zahlung Ihres Gehalts auf und setzen Sie ihm hierzu eine Frist.
- Sie können Ihre Arbeit verweigern.
- Sie haben das Recht auf Schadensersatz (§ 628 Abs. 2 BGB).
- Ihnen stehen außerdem Zinsen zu.
- Verklagen Sie Ihren Arbeitgeber auf Zahlung.
- Sie haben die Möglichkeit, fristlos zu kündigen.
- Sie können Arbeitslosengeld beantragen.
Wie verweigere ich meine Arbeit?
Sollte sich Ihr Arbeitgeber mit der Lohnzahlung im Rückstand befinden, können Sie von Ihrem Recht der Arbeitsverweigerung Gebrauch machen (§ 273 BGB). Dies wird auch Zurückbehaltungsrecht genannt. Bevor Sie jedoch einfach nicht mehr zur Arbeit gehen, sollten Sie Ihren Arbeitgeber von Ihrem Recht in Kenntnis setzen und androhen, dass Sie davon demnächst Gebrauch machen werden. In folgenden Fällen haben Sie allerdings kein Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern:
- Es ist absehbar, dass die eingetretene Lohnverzögerung nur von kurzer Dauer ist.
- Der Rückstand des Lohns ist nur relativ gering, dies bedeutet, es stehen weniger als eineinhalb beziehungsweise zwei Monatsgehälter aus.
- Bei Ihrer Lohnforderung geht es ausschließlich um Insolvenzforderungen.
- Ihr Lohnanspruch als Arbeitnehmer ist gesichert.
- Wenn Ihrem Arbeitgeber durch Ihre Arbeitsverweigerung ein immens hoher Schaden entstehen würde.
Haben Sie allen Grund dazu, Ihre Arbeitsleistung zu verweigern, darf der Arbeitgeber Sie deshalb nicht abstrafen und insbesondere nicht kündigen. In der Zeit der Arbeitsverweigerung steht Ihnen zudem jene Bezahlung zu, als hätten Sie gearbeitet.
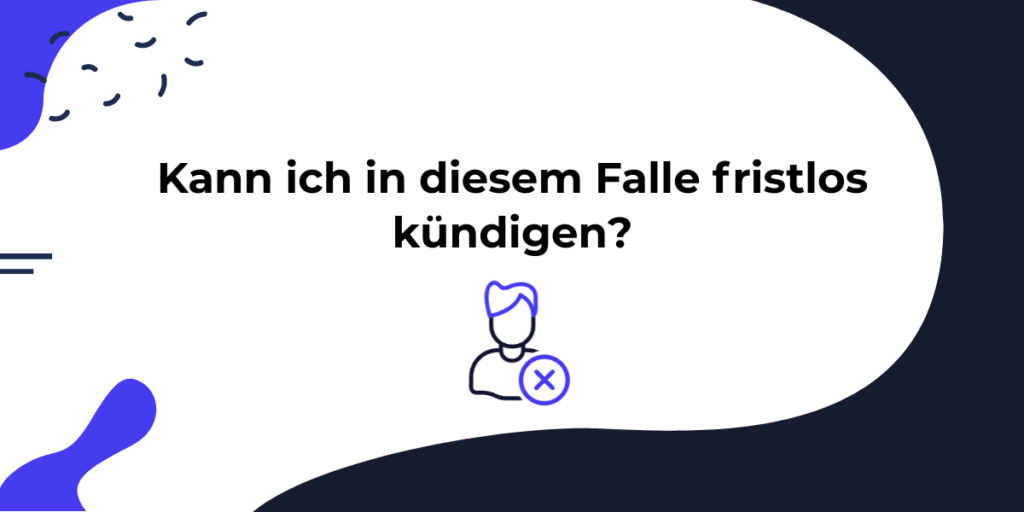
Dürfen Arbeitnehmer fristlos kündigen, wenn das Gehalt ausbleibt?
Ja, nach erfolgter Abmahnung ist dies durchaus möglich. Hier gelangen Sie zu unserer kostenlosen Abmahnung-Vorlage. Zunächst einmal sollten Sie beim Ausbleiben Ihres Lohns zuerst die Formalien studieren, ob eine fristlose Kündigung in diesem Fall überhaupt zulässig ist. Für eine fristlose Kündigung muss gemäß § 626 Abs. 1 BGB immer ein wichtiger Grund vorliegen. Allgemein gilt jedoch, sobald die Lohnzahlung ausbleibt, der Arbeitgeber sich im Zahlungsverzug befindet und das in erheblicher Form, stellt dies einen fristlosen Kündigungsgrund dar. Konkret heißt dies, dass sich der Arbeitgeber dafür mindestens zwei Monate im Zahlungsverzug befinden muss beziehungsweise zwei Monatsgehälter ausstehen. Außerdem muss der Arbeitnehmer vor fristloser Kündigung eine Abmahnung gegenüber dem Arbeitgeber ausgesprochen haben. Auf unserer Seite finden Sie zudem eine kostenlose Vorlage zum Thema: Kündigung Arbeitsvertrag.
Wohin können sich Arbeitnehmer bei ausbleibendem Gehalt wenden?
Sobald Sie feststellen, dass Ihr Lohn ausbleibt, sollten Sie schon die ersten Schritte einleiten. Zuerst sollten Sie sich in jedem Fall erst einmal an den Arbeitgeber selbst wenden. Setzen Sie ihm zur Zahlung Ihres Gehalts eine Frist und erst, wenn er innerhalb dieser Frist der Zahlung nicht nachkommt, ist es sinnvoll, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Sind Sie Gewerkschaftsmitglied, können Sie sich auch an Ihre zuständige Gewerkschaft wenden. Möchten Sie weitere juristische Schritte einleiten, können Sie dies vor dem Arbeitsgericht tun. Zudem kann Sie die Arbeitsagentur auf einen möglichen Anspruch auf Arbeitslosengeld beraten.
Wie lange darf der Arbeitgeber den Lohn nicht zahlen?
Wann Ihr Gehalt ausgezahlt wird, ist üblicherweise im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt. Üblicherweise wird das Gehalt monatlich gezahlt. Dabei ist zu beachten, dass das Gehalt spätestens am ersten Tag des Folgemonats auf dem Konto sein muss.
Die gesetzliche Fälligkeit des Gehalts ist aus § 614 BGB zu entnehmen. Hierin ist festgehalten, dass die Zahlung des Gehalts nach der Arbeitsleistung zu vergüten ist. Sofern sich die Zahlung jedoch nach verschiedenen Zeitabschnitten berechnet, ist die Zahlung immer jeweils mit Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte fällig. Einige Tarif- oder Arbeitsverträge können von dieser Regelung allerdings abweichen, willkürlich darf dies aber auch nicht erfolgen. Oftmals ist ein gewisser „Spielraum“ vorgesehen, der sich meistens bis zum 1. oder 15. des Folgemonats beläuft. Später jedoch darf der Zeitpunkt nicht sein. Wichtig für Betriebe mit Betriebsrat: Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG hat auch der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich Ort, Zeit und Art der Lohnzahlung.
Arbeitgeber dürfen unter keinen Umständen weiter als bis zum 15. des Folgemonats die Gehaltszahlung hinauszögern. Ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg erklärte im Jahr 2017 einen Arbeitsvertrag für unwirksam, worin ein Fälligkeitsdatum des Gehalts bis zum 20. des Folgemonats festgehalten war (Urteil LAG Baden-Württemberg vom 09,10,2017, Az.: 4 Sa 8/17). Das Gericht sah dies als unangemessene Benachteiligung für den Arbeitnehmer. Weiter führte es aus, dass solch eine Abweichung nur zulässig sei, wenn sich die Vergütungsbestandteile jeden Monat neu berechnen würden. In solchen Fällen wäre ein Hinauszögern allemal bis zum 15. des Folgemonats noch zu akzeptieren. Zumindest aber dann, wenn vorher ein Vorschuss des Gehalts gezahlt werden würde. Im hiesigen Fall lag jedoch keine wechselnde monatliche Abrechnung vor. Hier gelangen Sie zu unserem Arbeitsvertrag Muster.
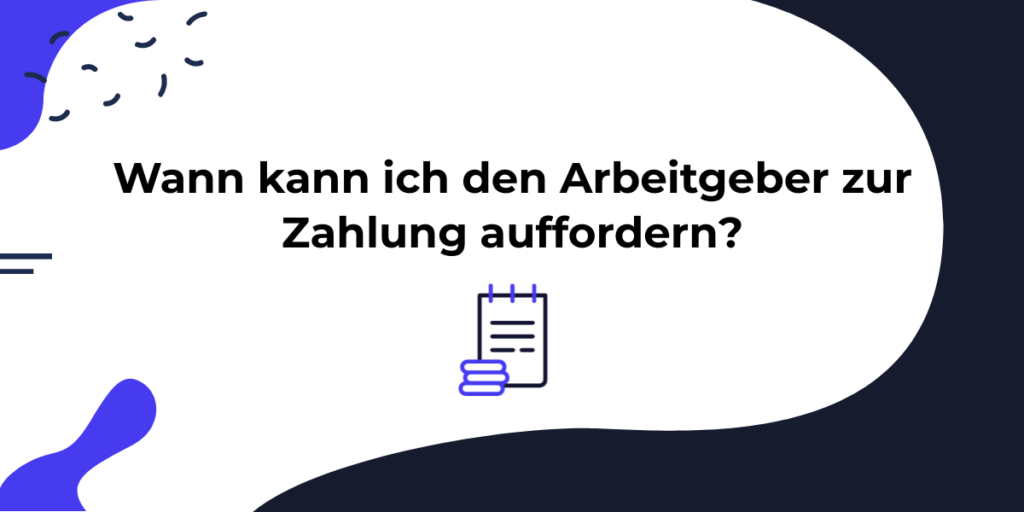
Wann kann der Arbeitgeber zur Zahlung des ausstehenden Gehalts aufgefordert werden?
Sollte Ihr Gehalt bis zum vereinbarten Termin der Fälligkeit ausbleiben oder nur teilweise erfolgen, fordern Sie Ihren Arbeitgeber zur Zahlung auf. Achten Sie dabei allerdings auf die Fristen: Oftmals sind in Arbeits- oder Tarifverträgen sogenannte Ausschlussfristen geregelt, die sehr kurz sein können. Diese sollten Sie unbedingt im Voraus prüfen. Sollte Sie Ihre Zahlung nicht innerhalb dieser Frist einfordern, kann dies unter Umständen Auswirkungen auf Ihren Anspruch des Gehalts haben. Sollten Sie dennoch diese Ausschlussfrist versäumt haben, holen Sie sich unbedingt rechtlichen Rat ein. Ein Anwalt kann Ihnen eventuell noch die Chancen einer Klage vor Gericht erläutern.
Wie fordere ich korrekt mein Gehalt ein?
Zunächst sollten Sie bestenfalls ein Schreiben an Ihren Arbeitgeber aufsetzen, in dem die konkrete Anspruchssumme genannt wird. Im Idealfall erstellen Sie hierzu eine Auflistung, wann und wie Sie gearbeitet haben. Bedenken Sie, dass Sie die Summen genau angeben müssen, die Ihnen Ihr Arbeitgeber schuldet. Zur Zahlung des ausstehenden Gehalts setzen Sie ihm eine Frist von zwei Wochen. Geben Sie auch unbedingt Ihre Kontodaten im Schreiben an und vergessen Sie nicht, zu unterschreiben.
Wenn Sie den Brief per Post verschicken, sollten Sie dies unbedingt per Einschreiben vollziehen, damit Sie einen Nachweis über den Zugang haben. Besser noch, Sie geben ihn persönlich ab. Eine Durchschrift des Schreibens sollte bei Ihren Unterlagen verbleiben. Übrigens ist es auch erlaubt, Ihren Arbeitgeber per SMS, E-Mail, Fax oder gar WhatsApp zur Zahlung aufzufordern. Eine telefonische oder mündliche Zahlungsaufforderung hingegen ist nicht wirksam.
Wie viel Lohn kann ich einfordern?
Wichtig ist, dass Sie unbedingt den richtigen Betrag geltend machen. Gefordert wird stets der Bruttostundenlohn beziehungsweise Bruttomonatslohn. Dabei gehen Sie wie folgt vor:
- Zunächst einmal sollten Sie Ihren Anspruch des Bruttolohns des entsprechenden Monats berechnen. Hierzu multiplizieren Sie Ihre Arbeitsstunden mit Ihrem Stundenlohn. Kommen bei Ihnen eventuell noch Nacht- oder Feiertagszuschläge hinzu, rechnen Sie diese dazu.
- Wenn Sie schon teilweise Anzahlungen erhalten haben, führen Sie diese auf, jedoch als Nettosumme.
- Wichtig ist, dass Sie keinen Endbetrag errechnen, sondern einfach Ihren Bruttoanspruch einfordern und sämtlich erhaltene Nettobeträge angeben. Es wird kein Netto vom Brutto abgezogen.
Kostenlose Vorlage: Abmahnung - Gehalt / Lohn
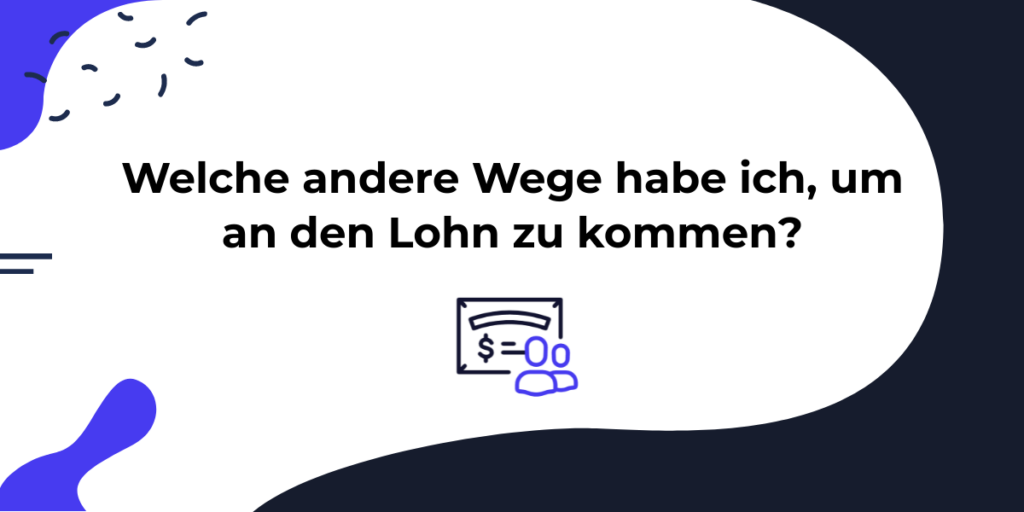
Kann ich meinen Lohn auch von anderer Stelle gezahlt bekommen?
Über das Insolvenzverfahren
Oft ist es der Fall, dass der Arbeitgeber Ihnen zwar gerne Ihr Gehalt zahlen würde, dies aber einfach finanziell nicht mehr kann. Meistens steht dem Arbeitgeber dann die Insolvenz bevor. Sie können dann aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers neben Ihrem Gehaltsanspruch auch einen sozialrechtlichen Anspruch auf das Insolvenzgeld haben. Geltend machen können Sie diesen Anspruch bei der Bundesagentur für Arbeit. Um ein Anrecht auf Insolvenzgeld zu haben, muss jedoch zunächst ein Insolvenzereignis vorliegen. Folgende Insolvenzereignisse sind denkbar:
- Der Insolvenzantrag wird mangels Masse abgewiesen.
- Das Insolvenzverfahren über das Vermögen Ihres Arbeitgebers wurde eröffnet.
- Der Betrieb hat seine Tätigkeit vollständig eingestellt.
Der Insolvenzgeldanspruch umfasst in aller Regel Ihre drei letzten Monatsgehälter vor Eintritt des Insolvenzereignisses.
Über die Bundesagentur für Arbeit
Möchten Sie von Ihrem Arbeitsverweigerungsrecht Gebrauch machen oder ziehen die fristlose Kündigung in Erwägung, können Sie sich an die Arbeitsagentur wenden, um sich über einen möglichen Anspruch auf Arbeitslosengeld zu informieren.
Fazit zum Thema: Arbeitgeber zahlt Lohn nicht
Zahlt Ihr Arbeitgeber Ihr Gehalt nicht oder nur teilweise, dann müssen Sie dabei nicht tatenlos zusehen. Sofern noch ein Arbeitsverhältnis besteht, sollten Sie zunächst einmal das Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber suchen. Manchmal kann es auch vorkommen, dass nur ein buchhalterischer Fehler die Ursache vom Ausbleiben des Gehalts ist. Ist dies jedoch nicht der Fall, dann können Sie Ihren Chef schriftlich abmahnen beziehungsweise zur Zahlung auffordern. Außerdem können Sie sogar Schadensersatz und Zinsen fordern.

Häufig gestellte Fragen
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Wo kann ich mich melden, wenn der Arbeitgeber mein Gehalt nicht zahlt?
Sie können sich zwei Wochen nach Zahlungsaufforderung an das zuständige Arbeitsgericht wenden und Ihren Anspruch gerichtlich durchsetzen. Eine weitere Alternative kann auch das gerichtliche Mahnverfahren darstellen.
Was kostet eine Klage auf Lohn?
Vor dem Arbeitsgericht herrscht kein Anwaltszwang, dies bedeutet, dass Sie grundsätzlich selbst eine Lohnklage einreichen können. Vorteil davon ist, dass keine Anwaltskosten entstehen. Auch Gerichtskosten entfallen erst einmal, da das Arbeitsgericht für eine Zustellung der Lohnklage keine Gebühren verlangt.
Wie lange kann eine Lohnklage dauern?
Bis über eine solche Klage entschieden wird, können gut und gerne drei bis vier Monate ins Land gehen. Oftmals reichen jedoch die finanziellen Mittel der Arbeitnehmer über so einen langen Zeitraum nicht um.