- Mietrecht
- Lesezeit: 05:33 Minuten
Sonderkündigungsrecht Vermieter: Rechte laut § 573 BGB

- Ein Vermieter darf nur kündigen, wenn er bestimmte Gründe vorweisen kann, wie etwa Eigenbedarf oder Zahlungsverzug durch den Mieter.
- In bestimmten Situationen, wie wenn der Mieter in einer Einliegerwohnung wohnt oder in einem Zweifamilienhaus, das vom Vermieter teilweise bewohnt wird, kann der Vermieter eine Sonderkündigung aussprechen.
- Im Falle von Eigenbedarf oder anstehenden Modernisierungen kann der Vermieter das Mietverhältnis fristgerecht beenden.
- Bei Vorliegen bestimmter schwerwiegender Bedingungen, wie Gefährdung anderer Bewohner oder Mietrückständen, kann der Vermieter eine fristlose Kündigung aussprechen.
- Nach einer Sonderkündigung ist es die Pflicht des Mieters, die Wohnung in einem sauberen und leeren Zustand zu hinterlassen. Ansonsten kann der Vermieter Reinigungsmaßnahmen auf Kosten des Mieters veranlassen.
Üblicherweise werden in einem Mietvertrag Kündigungsfristen für Mieter vereinbart. Mieter können innerhalb von drei Monaten ohne Angabe von Gründen kündigen. Dabei unterliegen Vermieter jedoch anderen Regeln. Als Vermieter können Sie nur kündigen, wenn Sie dafür besondere Gründe haben und diese auch nachweisen können. Ein Vermieter kann also nur vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, wenn etwas Unvorhergesehenes oder Atypisches vorausgegangen ist.
Im nachfolgenden Ratgeber erfahren Sie alles über das Sonderkündigungsrecht nach § 573a BGB, die fristlose Kündigung und die damit einhergehenden Rechte und Pflichten.
Wann greift das Sonderkündigungsrecht?
Grundsätzlich verhält es sich so, dass Vermieter nur kündigen können, wenn sie daran ein berechtigtes Interesse nachweisen können. Das kann zum Beispiel entweder die Kündigung wegen Eigenbedarf sein oder wenn sich der Mieter mit den Mietzahlungen im Rückstand befindet.
Die zwei Voraussetzungen zur Sonderkündigung nach § 573a BGB
Bei einer Kündigung gemäß § 573a BGB müssen zwei Gegebenheiten vorliegen, um ein Sonderkündigungsrecht zu haben:
- Der Mieter wohnt in einer Einliegerwohnung, die sich im selben Haus befindet, das der Vermieter ebenfalls bewohnt.
- Der Mieter wohnt in einem Zweifamilienhaus, welches zwei Wohnungen besitzt und der Vermieter davon eine Wohnung selbst bewohnt.
Liegt einer der beiden Fälle vor, so muss der Vermieter seine Kündigung nicht begründen. Dies bedeutet, dass er also kein berechtigtes Interesse, wie beispielsweise bei anderen Eigenbedarfskündigungen, nachweisen muss. Als Vermieter können Sie sich hierbei auf den § 573a BGB berufen, der eine vereinfachte Kündigung des Vermieters vorsieht.
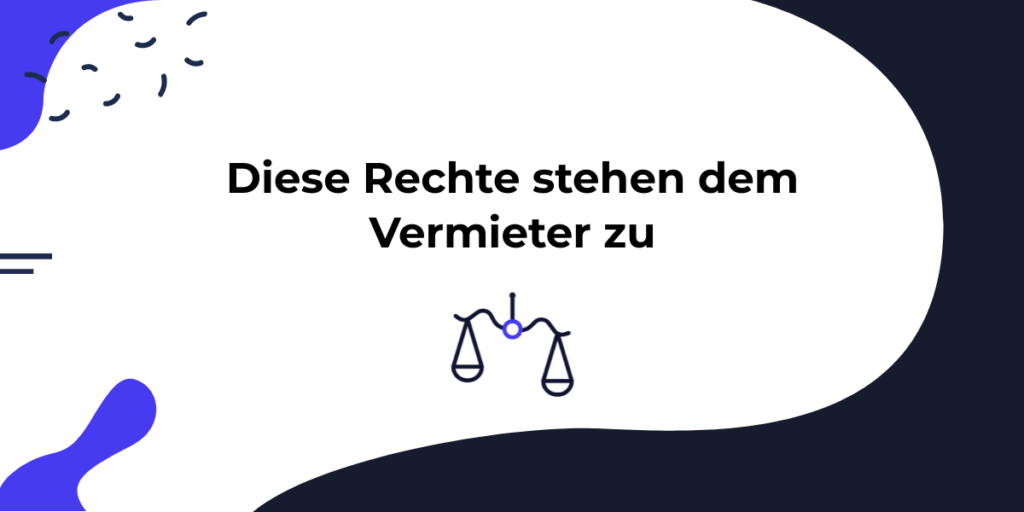
Welche Rechte hat der Vermieter?
Einer der Gründe, in denen der Vermieter das Sonderkündigungsrecht aussprechen kann, ist die Anmeldung von Eigenbedarf. Dies erfolgt dann, wenn er selbst oder eine andere ihm nahestehende Person in diese Wohnung einziehen möchte. Als Vermieter haben Sie dann das Recht unter Einhaltung der gesetzlichen Frist wegen Eigenbedarf nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB zu kündigen. Solch ein Fall kann eintreten, wenn Sie als Vermieter zukünftig entweder Ihre Mutter oder Ihren Vater in den Wohnräumen pflegen müssen.
Auch bei bevorstehenden Modernisierungen kann der Vermieter das Mietverhältnis fristgerecht beenden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sich Baumängel herausstellen, die insbesondere für Mieter eine Gefahr darstellen. Er muss in diesem Fall sogar kündigen, damit die Sicherheit der Bewohner wiederhergestellt werden kann.
Infolge von Modernisierungsarbeiten kommt es meist auch dementsprechend zu Mieterhöhungen. Akzeptiert ein Mieter diese Mieterhöhung nicht, so kann der Vermieter ebenfalls vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.
Fristlose Kündigungen des Mietverhältnisses werden überdies dem Vermieter zugestanden, wenn der betroffene Mieter beispielsweise eine Gefahr für andere Bewohner darstellt. Dies kann vorliegen, wenn der Mieter sich gesetzeswidrig verhält, die Hausordnung missachtet oder gewisse Versäumnisse, wie Mietrückstand bestehen. Mieter haben übrigens kein Recht auf Zurückhaltung der Miete; auch dann nicht, wenn in den Wohnräumen Mängel festgestellt werden.
Welche Pflichten hat der Mieter nach einer Sonderkündigung?
Als Mieter müssen Sie nach einer Sonderkündigung beim Auszug die Wohnung leer und sauber übergeben. Es dürfen keine Gegenstände zurückgelassen werden. Sollte dies doch der Fall sein, kann der Vermieter auf Kosten des Mieters eine Entrümpelungsfirma beauftragen. Dies gilt allerdings nicht, wenn es sich um einige wenige Gegenstände handelt, die ohne Wert sind.
Haben Sie die Wohnung leer geräumt, ist in den meisten Mietverträgen der Zusatz enthalten, die Wohnung „besenrein“ zu übergeben. Allerdings kann dies nicht wörtlich genommen werden, denn ein grobes Durchfegen mit einem Besen reicht hier nicht aus. Andererseits darf aber auch kein zu hoher Aufwand an den Mieter gestellt werden. Grundsätzlich sollte die Wohnung so hinterlassen werden, dass ein Nachmieter direkt einziehen kann, ohne vorher groß putzen zu müssen. Besenrein bedeutet deshalb:
- Etwaige Verschmutzungen an Wänden, Decken oder Böden müssen entfernt werden.
- Ein eventuell vorhandener Teppichboden muss gesaugt beziehungsweise der Boden gefegt werden
- Fenster, Türen und Heizkörper sowie Bad- und Kücheneinrichtungen müssen gewischt werden.
Findet der Vermieter eine nicht ordnungsgemäß geputzte Wohnung vor, kann er eine Reinigungsfirma beauftragen, dessen Kosten dem Mieter auferlegt werden.
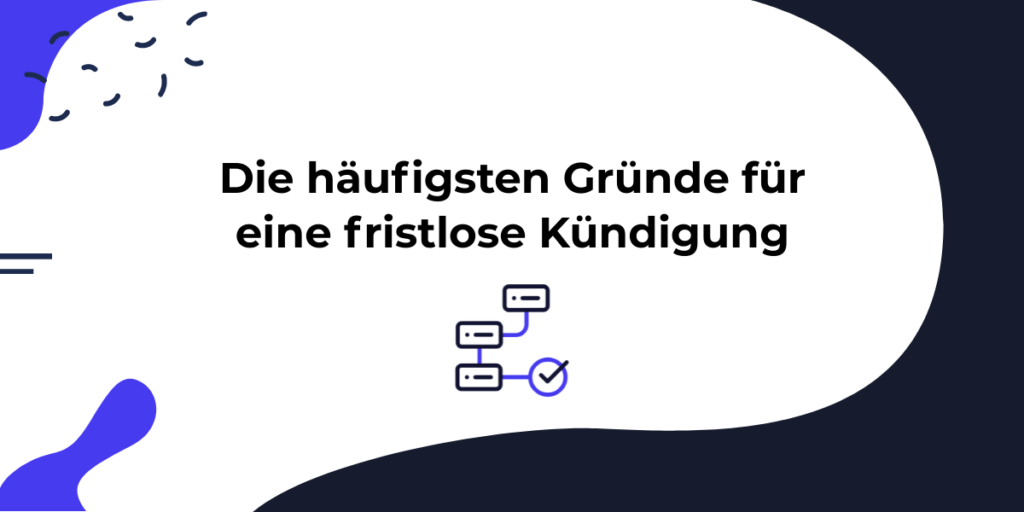
Die drei häufigsten Gründe für eine fristlose Kündigung
Als Vermieter haben Sie zudem das Recht, aus einigen anderen Gründen fristlos zu kündigen, auch wenn Sie Mietzahlungen immer fristgerecht erhalten. Nachfolgend stellen wir Ihnen die drei häufigsten Gründe für eine fristlose Kündigung vor.
- Ihr Mieter kommt den Mietzahlungen zwar nach, dies aber immer unpünktlich. Als Vermieter haben Sie in diesem Fall das Recht, fristlos zu kündigen. Hierzu bedarf es vorher allerdings einer Abmahnung, die der Mieter ebenfalls unberücksichtigt lassen muss (Urteil BGH vom 01.06.2011, Az.: VIII ZR 91/10).
- Anders liegt der Fall bei einer nicht gezahlten Kaution. Ist Ihr Mieter mit der Kautionszahlung im Rückstand und beträgt die offene Summe eine zweifache Monatsmiete, so können Sie sogar ohne Abmahnung fristlos kündigen (§ 569 Abs. 2a BGB). Für Mieter gibt es hier auch keine Schonfrist, in der sie nachzahlen könnten.
- Liegen gegen Ihren Mieter Straftaten vor, so können Sie ebenfalls fristlos kündigen. Hierzu gehören zum Beispiel Tätlichkeiten, Beleidigungen, Diebstahl von Strom oder Bedrohungen. All das sind Gründe für eine fristlose Kündigung. Wichtig ist dabei immer, die Gesamtsituation zu betrachten: Wie hat sich die Situation entwickelt und gab es eventuell vorher schon Provokationen?
Haben auch Mieter das Recht auf fristlose Kündigung?
Auch Mieter dürfen fristlos kündigen; aber ebenfalls nur in besonderen Fällen. Stellt der Vermieter die Wohnung nicht fristgerecht zur Verfügung (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB) oder wird die Wohnung als gesundheitsgefährdend eingestuft (§ 569 Abs. 1 BGB), so besteht seitens des Mieters das Recht auf eine außerordentliche Kündigung. Mieter sollten sich auf alle Fälle vor einer fristlosen Kündigung von einem Fachanwalt für Mietrecht oder vom Mieterverein informieren lassen.
Fazit zum Sonderkündigungsrecht Vermieter
Es kann festgehalten werden, dass das Sonderkündigungsrecht bei Mietverträgen in nur wenigen Ausnahmefällen greift. Das Gleiche gilt für fristlose Kündigungen. Sollten Sie als Mieter also planen, aus beruflichen oder privaten Gründen umzuziehen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie rechtzeitig kündigen. Ein Recht auf Sonderkündigung würde hier nämlich nicht existieren. Behalten Sie deshalb als Mieter im Hinterkopf, Ihren Mietvertrag spätestens drei Monate vor dem Einzug in die neue Wohnung zu kündigen. So vermeiden Sie zudem finanzielle Doppelbelastungen.

Häufig gestellte Fragen zum Sonderkündigungsrecht des Vermieters
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Wie kommt man vorzeitig aus dem Mietvertrag heraus?
Als Mieter haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kündigungsfrist zu verkürzen, wenn eine Situation vorliegt, die bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war. Das können entweder Modernisierungs- oder Baumaßnahmen sein. Sobald Ihnen die Ankündigung über Modernisierungsmaßnahmen vorliegt, können Sie bis zum Ende des darauffolgenden Monats schriftlich die Sonderkündigung vornehmen. Bei Mieterhöhungen können Sie die außerordentliche Kündigung bis zum Ende des übernächsten Monats seit der Ankündigung vollziehen.
Wie muss eine Kündigung aussehen?
Eine Kündigung bedarf immer der Schriftform und muss zudem fristgerecht dem Empfänger zugestellt werden (§ 568 BGB). Ebenfalls sollte die Kündigung eine Begründung und Unterschrift enthalten. Eine Kündigung ist erst wirksam, wenn sie als zugestellt gilt.
Können Vermieter vorzeitig kündigen?
Möchte der Vermieter fristlos kündigen, bedarf es vorher mindestens einer Abmahnung. Fristlose Kündigungen seitens des Vermieters sind üblicherweise nur möglich, wenn schwerwiegende Vertragsverletzungen des Mieters vorliegen.