- Firmengründung
- Lesezeit: 09:51 Minuten
Firmeninsolvenz Einzelunternehmen: Dauer, Ablauf & Haftung
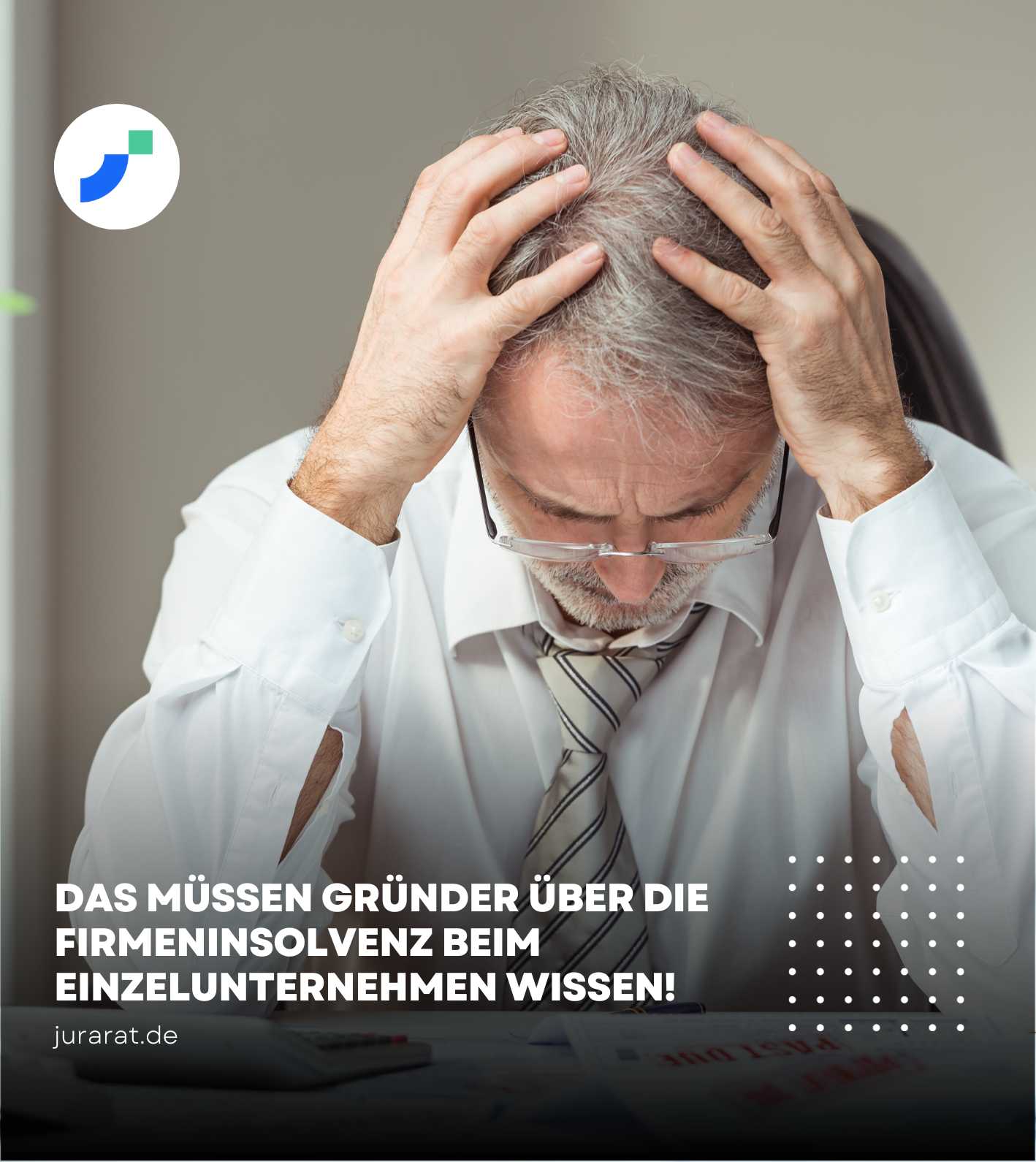
- Eine Firmeninsolvenz tritt auf, wenn die Ausgaben einer Firma höher sind als die Einnahmen und sie nicht in der Lage ist, alle Schulden zu begleichen.
- Ein Einzelunternehmer haftet mit seinem gesamten Vermögen für die Schulden seines Unternehmens.
- Ein Einzelunternehmer ist nicht verpflichtet, Insolvenz anzumelden, aber es kann sinnvoll sein, dies frühzeitig zu tun, um weitere Schäden und die persönliche Haftung zu vermeiden.
- Eine Firmeninsolvenz bei einem Einzelunternehmen kann entweder im Rahmen eines Verbraucherinsolvenzverfahrens oder eines Regelinsolvenzverfahrens ablaufen.
- Das Insolvenzverfahren beginnt mit der Stellung eines Insolvenzantrags und endet mit dem Schlusstermin, bei dem das Vermögen des Unternehmens auf die Gläubiger verteilt wird.
- Die Dauer einer Firmeninsolvenz variiert, aber in der Regel dauert sie 3-4 Jahre.
- Nach Abschluss des Verfahrens besteht die Möglichkeit der Restschuldbefreiung.
Die meisten Existenzgründer kümmern sich im Vorfeld der Unternehmensgründung (logischerweise) um Fragen der Gewerbeanmeldung, Namensgebung des Einzelunternehmens oder um steuerliche Aspekte. Mit Fragen einer möglichen Insolvenz wird sich allerdings häufig erst dann beschäftigt, wenn sie bereits eingetreten ist. Da eine Insolvenz für den Einzelunternehmer jedoch die denkbar schlechteste Abzweigung ist, die sein Unternehmen nehmen kann, ist eine Kenntnis der wichtigsten Pflichten und Möglichkeiten des Einzelunternehmers im Falle einer Insolvenz unentbehrlich. Was eine Firmeninsolvenz überhaupt ist, was sie kostet, wie die Haftung des Einzelunternehmers ausgestaltet ist und wie die Firmeninsolvenz bei einem Einzelunternehmen abläuft, wird in diesem Beitrag verständlich erläutert. Außerdem wird dargestellt, wie lange ein Insolvenzverfahren dauert und welche Möglichkeiten der Einzelunternehmer nach Abschluss des Insolvenzverfahrens hat.
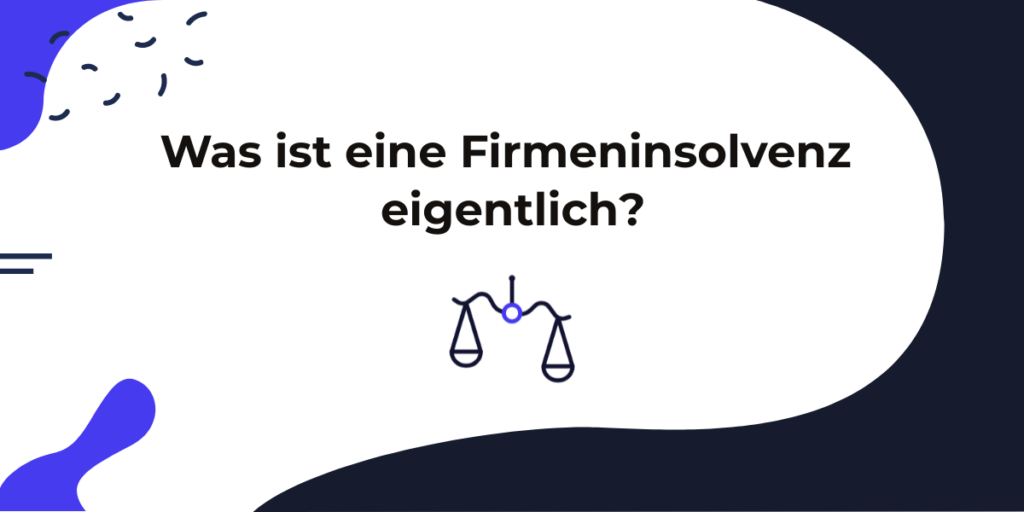
Was ist eine Firmeninsolvenz?
Der Begriff „Insolvenz“ bezeichnet die Situation, dass die Ausgaben einer Person aktuell oder zumindest in absehbarer Zeit höher sind als ihre Einnahmen. Die Person ist also nicht mehr in der Lage, alle ihre Ausgaben ihren Gläubigern gegenüber, also gegenüber den Personen, die einen Zahlungsanspruch gegen sie haben, zu bezahlen. Betrifft diese Zahlungsunfähigkeit nicht eine Privatperson, sondern eine Firma, spricht man von einer Firmeninsolvenz. Die Ursache hierfür sind vielfältig: Häufig wird die Firmeninsolvenz durch fehlerhafte Preiskalkulationen, Fehlinvestitionen oder falsch eingeschätzte Geschäftsrisiken hervorgerufen. Allerdings kann die Firmeninsolvenz auch durch Einflüsse von außen entstehen, beispielsweise aufgrund von nicht kalkulierbaren Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Krise oder der Insolvenz von Geschäftspartnern, die ihre Schulden somit nicht oder nicht mehr vollständig begleichen können.
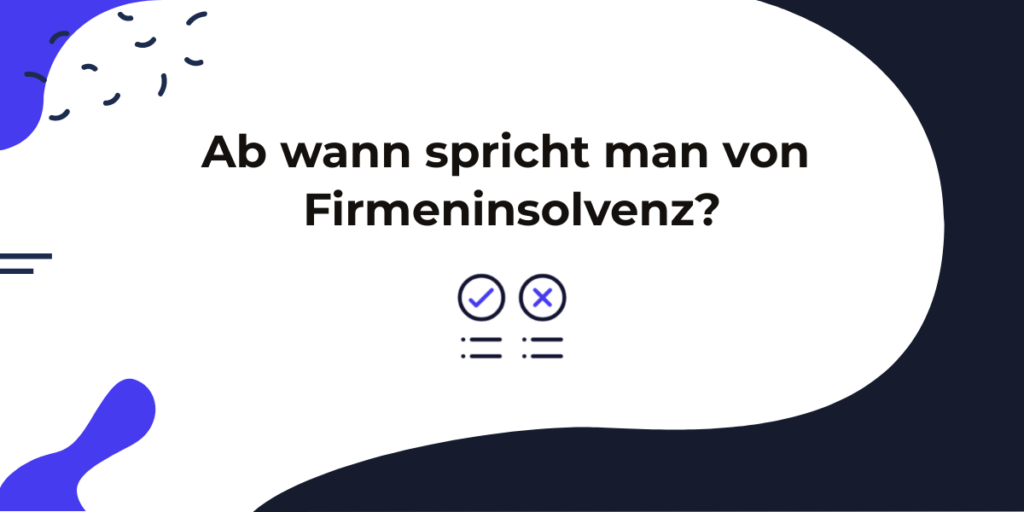
Ab wann spricht man von einer Firmeninsolvenz?
Ob und ab wann ein Unternehmen insolvent ist, richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen der Insolvenzordnung (InsO). Demnach ist ein Unternehmen dann als insolvent anzusehen, wenn das Insolvenzverfahren eingeleitet wurde. Für die Einleitung des Insolvenzverfahrens muss mindestens einer der folgenden drei Eröffnungsgründe vorliegen.
Zahlungsunfähigkeit, § 17 InsO: Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
Drohende Zahlungsunfähigkeit, § 18 InsO: Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen.
Überschuldung, § 19 InsO: Überschuldung liegt vor, wenn die gesamten bestehenden Verbindlichkeiten, also die Schulden, das vorhandene Gesamtvermögen des Unternehmens übersteigen.
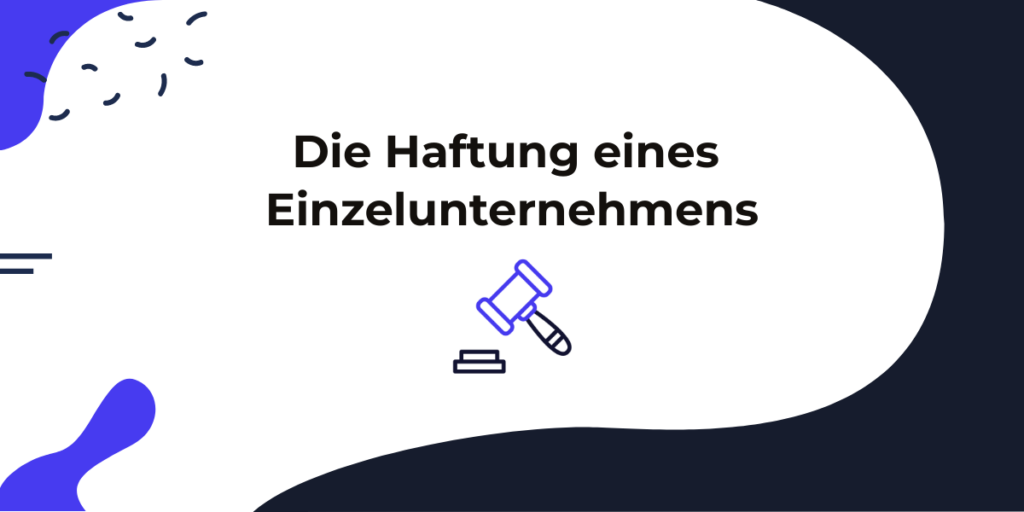
Die Haftung eines Einzelunternehmens
Einzelunternehmer können immer für die Schulden des Einzelunternehmens in Anspruch genommen werden, anders als bei anderen Unternehmensformen wie beispielsweise der GmbH besteht keine Haftungsbeschränkung. Da der Einzelunternehmer mit seinem gesamten Vermögen haftet, kommt es im schlimmsten Fall also nicht nur zur Insolvenz des Einzelunternehmens, sondern gleichzeitig zur Privatinsolvenz des Einzelunternehmers. Das Gesetz macht dabei keinen Unterschied zwischen privaten Schulden und gewerblichen Schulden, also solchen, die der Einzelunternehmer gemacht hat. Erfahren Sie mehr über die Haftung bei Einzelunternehmen.
Muss ein Einzelunternehmer Insolvenz anmelden?
Während die Haftung beim Einzelunternehmer einen riesigen Nachteil zur Haftung in einer GmbH darstellt, ist die Insolvenz des Einzelunternehmens hinsichtlich der Insolvenzantragsstellung einen großen Vorteil gegenüber der GmbH: Der Geschäftsführer einer GmbH muss nämlich zwingend einen Insolvenzantrag stellen. Wenn er dies unterlässt oder nicht spätestens innerhalb von drei Wochen nach Eintritt von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung Insolvenz anmeldet, ist sogar eine strafrechtliche Verurteilung möglich. Demgegenüber obliegt dem Einzelunternehmer keine Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Damit kann er also wahlweise einen Insolvenzantrag stellen oder eben nicht. Trotzdem ist ein frühzeitiger Insolvenzantrag des Einzelunternehmers häufig sinnvoll, um weitere Schäden durch die persönliche Haftung des Einzelunternehmers zu verhindern sowie die Rettungschancen des Unternehmens zu erhöhen.
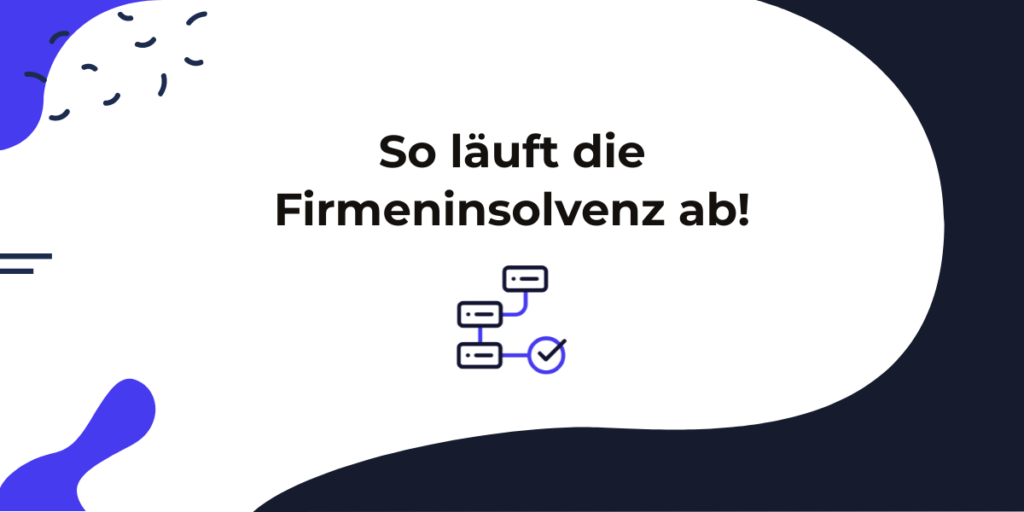
Wie läuft eine Firmeninsolvenz bei einem Einzelunternehmen ab?
Wie die Firmeninsolvenz beim Einzelunternehmer abläuft, ist abhängig davon, welche Art des Insolvenzverfahrens gewählt wird. Zu unterscheiden sind das Regelinsolvenzverfahren sowie das Privatinsolvenzverfahren, häufig auch Verbraucherinsolvenzverfahren genannt.
1. Privat- bzw. Verbraucherinsolvenzverfahren
Die Möglichkeit des Privat- bzw. Verbraucherinsolvenzverfahrens steht, wie der Name schon sagt, Privatpersonen bzw. Verbrauchern zu. Ein Einzelunternehmer kann nur dann Gebrauch von diesem Insolvenzverfahren machen, wenn er maximal 19 Gläubiger hat, also maximal 19 Personen offene Forderungen gegen ihn haben und keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.
2. Regelinsolvenzverfahren
In den meisten Fällen führt für den Einzelunternehmer jedoch kein Weg am Regelinsolvenzverfahren vorbei. Dieses läuft wie folgt ab:
a) Insolvenzantrag
Ein jedes Insolvenzverfahren beginnt mit der Stellung des Insolvenzantrags. Dieser Antrag muss beim zuständigen Insolvenzgericht gestellt werden, wobei die Antragstellung sowohl durch einen Gläubiger als auch durch den Schuldner selbst erfolgen kann. Die meisten Insolvenzgerichte stellen auf ihren jeweiligen Internetseiten einen entsprechenden Antrag zum Download bereit. Der Antrag des Schuldners muss dabei unter anderem folgende Angaben enthalten:
- Insolvenzgrund (§ 17, 18 oder 19 InsO)
- Auflistung sämtlicher Vermögensgegenstände
- Auflistung aller Gläubiger
- Tätigkeitsbereich des Unternehmens
- Auflistung sämtlicher noch offenen Forderungen
- Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter
Weiterhin muss der Schuldner dem Insolvenzantrag eine Erklärung beifügen, mit der bestätigt wird, dass die gemachten Angaben richtig und vollständig sind.
Sofern der Insolvenzantrag nicht vom Schuldner, sondern von einem der Gläubiger gestellt wird, muss dieser außerdem darlegen, dass er ein berechtigtes Interesse an der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat.
b) Insolvenzeröffnungsverfahren
Nachdem der Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenz gestellt würde, prüft das Gericht, ob die Voraussetzungen der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens tatsächlich vorliegen. In diesem Zeitraum wird das Verfahren als vorläufiges Insolvenzverfahren bezeichnet. Währenddessen hat das Gericht die Möglichkeit, konkrete Maßnahmen zu treffen, um das noch vorhandene Vermögen zu sichern, beispielsweise durch die Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters oder der Durchsetzung von Auskunftsansprüchen gegenüber dem Schuldner. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass sich das Unternehmen nicht weiter verschuldet.
Das vorläufige Insolvenzverfahren dauert in der Regel 2 bis 3 Monate. In dieser Zeit werden die Unternehmensgeschäfte durch den vorläufigen Insolvenzverwalter abgewickelt: Verträge dürfen nur mit seiner Zustimmung abgeschlossen werden, zudem erhält der vorläufige Insolvenzverwalter die Post, die an den Einzelunternehmer gerichtet ist. Obendrein darf das Gehalt der beschäftigten Arbeitnehmer in dieser Zeit nicht gekürzt werden. Sofern Gehaltszahlungen nicht geleistet werden können, erhalten die Arbeitnehmer bis zu 3 Monate lang Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit, das das fehlende Gehalt ausgleichen soll. Beendet wird das vorläufige Insolvenzverfahren durch den Eröffnungsbeschluss.
c) Eröffnungsbeschluss
Wenn das Gericht nach seiner Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass der Insolvenzantrag ordnungsgemäß gestellt wurde, ein Insolvenzeröffnungsgrund tatsächlich vorliegt und außerdem voraussichtlich ausreichend Vermögen (auch als „Insolvenzmasse“ bezeichnet) besteht, um die Kosten des Verfahrens zu decken, beschließt das Gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, § 27 InsO. Gleichzeitig wird sofort ein Insolvenzverwalter bestimmt. Ist das verfügbare Vermögen des Schuldners hingegen nicht ausreichend, wird der Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen, § 26 InsO.
d) Forderungsanmeldung
Anschließend fordert der Insolvenzverwalter alle Gläubiger des Schuldners auf, ihre Forderungen entsprechend anzumelden. Nur diejenigen Gläubiger, die ihre Forderungen ordnungsgemäß anmelden, werden im Insolvenzverfahren berücksichtigt. Eine Ausnahme hiervon besteht für Gehaltsrückstände bei Arbeitnehmern, diese werden vom Insolvenzverwalter selbst ermittelt und müssen daher nicht zwingend angemeldet werden. Die Forderungen werden sodann entsprechend der folgenden, gesetzlich vorgeschriebenen Reihenfolge beglichen:
1. Verfahrenskosten: Gehalt des Insolvenzverwalters und Gerichtskosten.
2. Masseverbindlichkeiten: Forderungen, die erst nach Verfahrenseröffnung entstanden sind.
3. Insolvenzverbindlichkeiten: Forderungen, die bereits vor Verfahrenseröffnung entstanden sind.
e) Berichtstermin
Nach einigen Wochen lädt das Gericht die Gläubiger zum sogenannten Berichtstermin ein. Dort erläutert der Insolvenzverwalter die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die Insolvenzursache sowie die Aussichten darauf, ob das Unternehmen gänzlich oder teilweise erhalten bleiben kann.
f) Gläubigerversammlung
Auf Grundlage dieses Berichtes muss die Gläubigerversammlung über das weitere Vorgehen im Insolvenzverfahren entscheiden. Dabei kann das Insolvenzverfahren zwei verschiedene Wege nehmen:
- Unternehmensauflösung: Das Unternehmen wird vollständig aufgelöst, alle Vermögenswerte werden veräußert und die Gläubiger entsprechend der oben dargestellten, gesetzlichen Rangfolge befriedigt.
- Unternehmenssanierung: Das Unternehmen wird „saniert“, es wird ein Plan festgelegt, nach dem das Unternehmen wieder Profitabilität erlangen soll (sog. „Sanierungsplan“). Hierbei versucht der Insolvenzverwalter, Geld für die Bezahlung der offenen Forderungen der Gläubiger zu erwirtschaften. Dies erfolgt beispielsweise durch die Aufnahme neuer Kredite oder durch Kündigung von Verträgen, die hohe laufende Kosten verursachen (etwa einen teuren Mietvertrag über Büroräume in bester Lage).
g) Schlusstermin
Sobald das Unternehmen aufgelöst oder die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wieder erreicht wurde, erstellt der Insolvenzverwalter einen Schlussbericht, den er beim Insolvenzgericht einreicht. Anschließend werden erneut der Schuldner sowie sämtliche Gläubiger, die ihre Forderungen angemeldet haben, zu einem Termin eingeladen. Dort wird ihnen vom Insolvenzverwalter über den Verlauf des Insolvenzverfahrens Bericht erstattet. Anschließend wird das Vermögen auf die Gläubiger wie oben dargestellt verteilt.
h) Aufhebung
Sobald der Schlusstermin beendet ist, beschließt das Insolvenzgericht in einem letzten Schritt die Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Diese wird außerdem auf der offiziellen Internetseite für Insolvenzbekanntmachungen veröffentlicht.

Woher weiß das Gericht, ob tatsächlich ein Insolvenzgrund vorliegt?
Um nicht ausschließlich auf die Angaben des Schuldners, die er im Insolvenzantrag gemacht hat, angewiesen zu sein, setzt das Gericht häufig einen Sachverständigen ein, der sich in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners einarbeitet. Dabei treffen den Schuldner gewisse Auskunfts- und Mitteilungspflichten, er muss also auf Anfrage aktiv mitwirken. Der Sachverständige erstellt anschließend ein Gutachten über die Vermögenslage des Schuldners, das das Gericht dann bei der Frage der Insolvenzeröffnung als Grundlage heranzieht.

Wie lange dauert eine Firmeninsolvenz?
Für die Dauer einer Firmeninsolvenz gibt es keine allgemeingültige Antwort. Die Dauer ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von der Größe des Unternehmens, der Höhe der Unternehmensschulden sowie der Anzahl der Gläubiger. In der Regel dauern Firmeninsolvenzen 3-4 Jahre, bei enorm großen Unternehmen, speziell Kapitalgesellschaften oder Stiftungen, kann sich das Insolvenzverfahren auf bis zu 10 Jahre hinziehen.
Was passiert nach dem Insolvenzverfahren?
Für Freiberufler und Einzelunternehmer besteht nach Auflösung des Unternehmens die Möglichkeit, Restschuldbefreiung zu erlangen. Hierdurch kann der Schuldner umfassend von seinen Schulden befreit werden, sodass er wirtschaftlich neu starten kann. Die Restschuldbefreiung wird nicht von Amts wegen, also nicht automatisch erteilt, sondern muss vom Schuldner beantragt werden. Dabei kann das Gericht die Restschuldbefreiung unter den Voraussetzungen des § 290 InsO ablehnen. Das ist etwa der Fall, wenn der Schuldner bereits in der Vergangenheit wegen Insolvenzstraftaten verurteilt wurde oder er während des Insolvenzverfahrens gegen seine Auskunfts- und Mitteilungspflichten verstoßen hat.
Welche Kosten entstehen beim Insolvenzverfahren?
Durch das Insolvenzverfahren entstehen eine Vielzahl von Kosten, die von dem Unternehmen selbst getragen werden müssen. Im Wesentlichen sind das die verursachten Gerichtskosten sowie die Vergütungen für den vorläufigen und den Hauptinsolvenzverwalter. Genau wie bei der Dauer des Insolvenzverfahrens lässt sich hier keine pauschale Angabe machen, da diese von mehreren Faktoren wie der Anzahl der Gläubiger, der Summe der Insolvenzmasse sowie der Insolvenzverfahrensdauer abhängig ist.
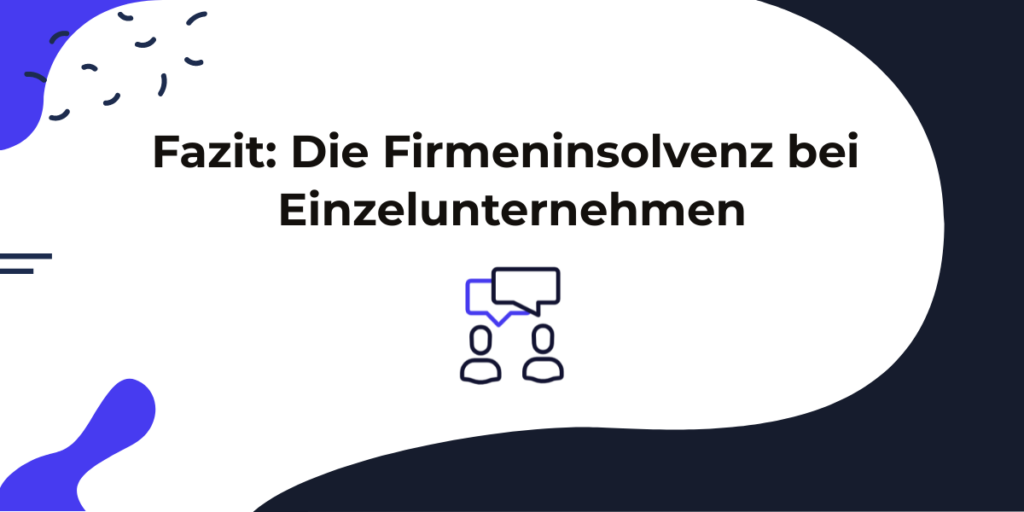
Fazit: Firmeninsolvenz Einzelunternehmen
Beim Einzelunternehmen ist zwischen dem Verbraucherinsolvenzverfahren und dem Regelinsolvenzverfahren zu unterscheiden, wobei in den meisten Fällen das Regelinsolvenzverfahren gewählt werden muss. Dieses beginnt mit dem Stellen eines Insolvenzantrags und wird mit dem Schlusstermin, in dem das noch vorhandene Vermögen des Selbstständigen nach gesetzlichen Vorschriften auf die vorhandenen Gläubiger verteilt wird, beendet. Ein Insolvenzverfahren dauert in der Regel 3-4 Jahre. Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, Restschuldbefreiung zu erlangen.

Häufig gestellte Fragen rund um die Insolvenz eines Einzelunternehmens
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was passiert, wenn ein Einzelunternehmen pleite geht?
Wenn ein Einzelunternehmen pleite geht, wird in den meisten Fällen ein Regelinsolvenzverfahren eingeleitet. Dieses beginnt mit dem Stellen eines Insolvenzantrags und endet mit dem Schlusstermin, in dem das noch vorhandene Vermögen des Unternehmens nach gesetzlichen Vorschriften auf die vorhandenen Gläubiger verteilt wird. Da der Einzelunternehmer mit seinem gesamten Vermögen haftet, kann es im schlimmsten Fall nicht nur zur Insolvenz des Unternehmens, sondern gleichzeitig zur Privatinsolvenz des Einzelunternehmers kommen.
Kann ein Einzelunternehmer Privatinsolvenz anmelden?
Ein Einzelunternehmer kann Privatinsolvenz anmelden, wenn er maximal 19 Gläubiger hat und keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Dies wird als Verbraucherinsolvenzverfahren bezeichnet. Allerdings müssen in den meisten Fällen Einzelunternehmer das Regelinsolvenzverfahren durchlaufen.
Wie lange läuft ein Firmeninsolvenzverfahren?
Die Dauer eines Firmeninsolvenzverfahrens ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von der Größe des Unternehmens, der Höhe der Unternehmensschulden sowie der Anzahl der Gläubiger. In der Regel dauern Firmeninsolvenzen 3-4 Jahre, bei sehr großen Unternehmen kann sich das Verfahren jedoch auf bis zu 10 Jahre hinziehen.