- Arbeitsrecht
- Lesezeit: 11:54 Minuten
Angestelltenverhältnis: Bedeutung & Scheinselbstständigkeit

- Ein Angestelltenverhältnis entsteht durch einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
- Angestellte sind weisungsgebunden und erhalten in der Regel ein festes monatliches Gehalt.
- Scheinselbstständigkeit tritt auf, wenn Arbeitnehmer als selbstständig auftreten, aber tatsächlich abhängig und weisungsgebunden sind.
- Arbeitgeber, die Scheinselbstständige beschäftigen, riskieren hohe Nachzahlungen an Sozialversicherungen.
- Die rechtliche Klärung einer Scheinselbstständigkeit erfolgt durch eine Statusklage vor dem Arbeitsgericht.
- Arbeitnehmerähnliche Personen sind wirtschaftlich abhängig, aber nicht weisungsgebunden und benötigen besonderen Schutz.
Oft stellt sich die Frage, wann genau ein Angestelltenverhältnis zustande kommt. Und was genau die Scheinselbstständigkeit ist. Und wie diese voneinander abgegrenzt werden können. Das ist mitunter sehr schwierig. Die Antworten dazu gibt es hier:
Wann entsteht ein Angestelltenverhältnis?
Stehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in einer sozialversicherungspflichtigen Beziehung, spricht das deutsche Recht von einem Angestelltenverhältnis (§§ 611 bis 622 BGB). Das Angestelltenverhältnis beruht auf einem privatrechtlichen Vertrag zwischen den beiden Parteien, dem Arbeitsvertrag. Hier gelangen Sie übrigens zu unserem kostenlosem Arbeitsvertrag Muster. Dieser Vertrag stellt eine Sonderform des Dienstvertrages dar und regelt alle gesetzlichen und individuellen Absprachen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zu diesen Punkten gehören die Festlegung der täglichen Arbeitszeit, die Höhe des Einkommens, die Anzahl der Urlaubstage, der Stellenbeschreibung sowie weiterer Rechte und Pflichten.
Was bedeutet es Angestellter zu sein?
Angestellte sind durch ihren Arbeitsvertrag weisungsgemäß an ihren Arbeitgeber gebunden. Weitere Definitionen des Angestelltenverhältnisses sind, dass diese Mitarbeiter nicht beamtet und keine maßgeblichen Miteigentümer des sie beschäftigenden Unternehmens sind, in der Regel ein monatliches festes Gehalt beziehen und unbefristet beschäftigt sind. Es gibt einfache Angestellte und übertariflich Angestellte, die in einem Betrieb tätig sind, der Tariflohn zahlt. Außertariflich sind Angestellte beschäftigt, deren Stellenbeschreibung keinen Tariflohn vorsieht (Spezialisten) oder deren Gehalt über dem maximalen Tariflohn liegt.
Leitende Angestellte sind gleichfalls abhängig und weisungsgebunden beschäftigt, jedoch verfügen sie über wesentliche Arbeitgeberbefugnisse wie Prokura sowie das Recht, Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen. Das Angestelltenverhältnis wird durch mehrere Gesetze und Vorschriften geregelt. Es findet Eingang in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und wird durch das Arbeitsrecht, Tarifverträge und interne Betriebsabsprachen geregelt. Diese Quellen beeinflussen Gestaltung, Form und Inhalt des Arbeitsvertrages.
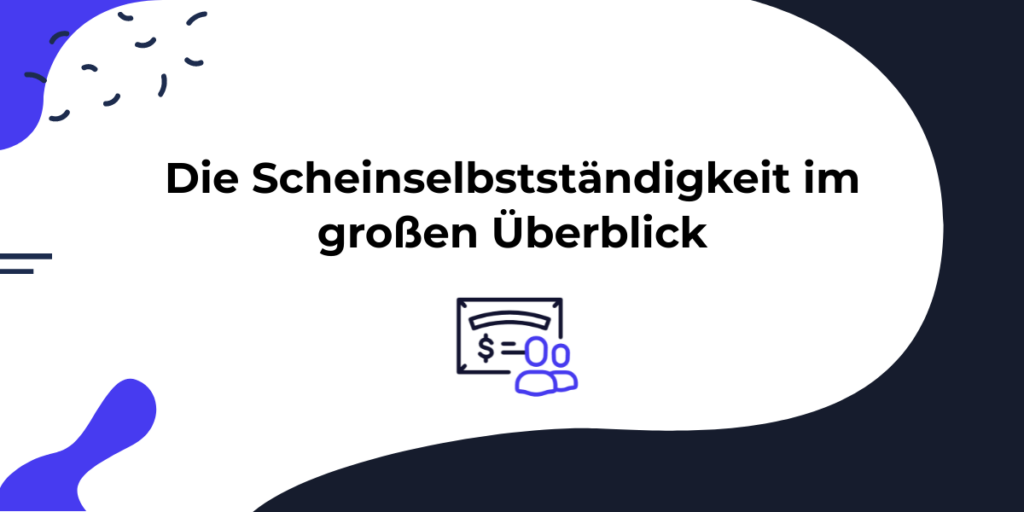
Welche Sicherheiten habe ich bei einem Angestelltenverhältnis?
Das Angestelltenverhältnis bietet Beschäftigungssicherheit, soziale Absicherung, Weiterbezahlung im Urlaubs- und Krankheitsfall und ein festes monatliches Einkommen. Der Arbeitnehmer unterliegt jedoch einem Kündigungsrisiko, muss sich an strikte Arbeitspläne und Arbeitszeiten halten und hat kaum Spielraum zur freien Gestaltung seines Tätigkeitsfeldes. Sein Arbeitsfeld ist klar strukturiert und der Arbeitsalltag bietet Planungssicherheit.
Arbeitnehmer in einem Angestelltenverhältnis müssen sich nicht um die Versteuerung ihres Einkommens kümmern, da ihnen ihr monatliches Gehalt nach Abzug aller Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge als Nettoeinkommen ausgezahlt wird. Ferner kennt das deutsche Arbeitsrecht weitere, individuell ausgestaltete Angestelltenverhältnisse wie Zeitarbeit, Teilzeitarbeitsverhältnisse und befristete Arbeitsverhältnisse.
Wann liegt eine Scheinselbstständigkeit vor?
Das größte Abgrenzungsmerkmal zwischen einer freiberuflichen Tätigkeit (§ 474 BGB) und einer Scheinselbstständigkeit ist das Merkmal der Sozialversicherungspflicht, die durch das Sozialversicherungsrecht geregelt wird. Eine Scheinselbstständigkeit liegt dann vor, wenn Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber abhängig und diesem gegenüber weisungsgebunden sind, obwohl sie nach außen hin als selbstständige Unternehmer in Erscheinung treten. Selbstständige Arbeitnehmer sind dann nicht mehr als selbstständig und damit als scheinselbstständig zu betrachten, wenn sie
- ausschließlich für einen Auftraggeber tätig sind
- den größten Teil ihres Umsatzes durch einen Auftraggeber erreichen
- ein regelmäßiges und erfolgsunabhängiges Entgelt beziehen
- keine unternehmertypischen Merkmale aufweisen
- in den Betriebsablauf und die Organisation des Arbeitgebers integriert sind
- für den Auftraggeber die gleichen Tätigkeiten ausüben wie zuvor als abhängig Beschäftigter,
- keine weitere Kundenakquise betreiben,
- ihre Leistungen vertragsgemäß nicht auf andere Personen übertragen dürfen und
- keinen eigenen Arbeitsplatz haben.
Wie zeichnet sich die Scheinselbstständigkeit aus?
Scheinselbstständigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass der Arbeitgeber steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Pflichten nicht erfüllt. Insbesondere in der Wirtschaft besteht eine hohe Neigung dazu, Tätigkeiten, die eigentlich durch angestellte Mitarbeiter verrichtet werden, an Subunternehmer und Privatpersonen als scheinbar selbstständige Unternehmer auszulagern.
Gemäß § 1 SchwarzAG handelt es sich um Schwarzarbeit sowie um Sozialversicherungs- und Steuerbetrug (§ 266 StGB, Wirtschaftsstrafrecht). Nach außen hin tritt die erwerbstätige Person als selbstständiger Unternehmer auf, obwohl die Art und Weise die eines weisungsgebundenen, abhängig Beschäftigten ist. Beide Parteien verschleiern ein Angestelltenverhältnis, um die Restriktionen des Steuerrechts, Arbeitsrechts und Sozialversicherungsrechts zu umgehen.
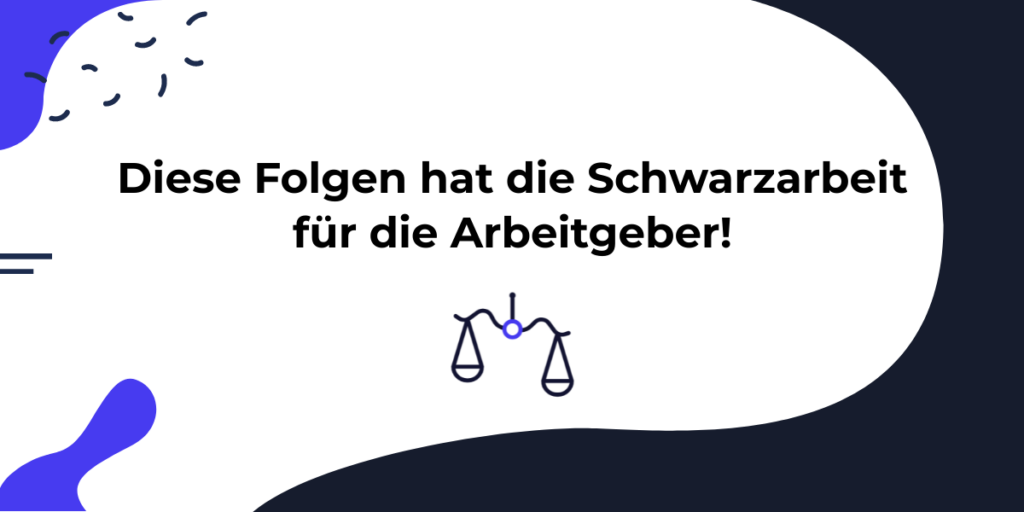
Welche Folgen kann die Schwarzarbeit für die Arbeitgeber haben?
Gerät ein Unternehmen in den Verdacht, Arbeitnehmer als Scheinselbständige zu beschäftigen, drohen hohe Nachzahlungssummen, die der Arbeitgeber nachträglich zur Renten-, Kranken,- Pflege- und Arbeitslosenversicherung zu entrichten hat. Die Sozialversicherungen sind berechtigt, ihren gesetzlichen Anspruch für einen Zeitraum von 30 Jahren durchzusetzen.
Der scheinselbstständige Arbeitnehmer haftet dagegen über einen Zeitraum von drei Monaten für seinen Anteil an den Sozialversicherungsbeiträgen. Für alle Zeiträume, die darüber hinausgehen, haftet der Arbeitgeber für die ausstehenden Arbeitnehmeranteile. Die regelmäßige Rechtsprechung verneint einen Regressanspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer, selbst wenn bewiesen ist, dass beide Parteien vorsätzlich gehandelt haben.
Wie wird rechtlich festgelegt, ob eine Scheinselbstständigkeit vorliegt?
Gemäß § 7 SGB ist die Frage, ob eine Scheinselbstständigkeit vorliegt oder nicht, nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beantworten. Hauptsächlich fragt der Gesetzgeber danach, ob der Arbeitnehmer seine Tätigkeit nach den Weisungen des Arbeitgebers ausführt und ob eine Eingliederung in die Organisation des Auftraggebers erfolgt ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, stehen Selbstständige in einem Angestelltenverhältnis zu ihrem Arbeitgeber und sind damit automatisch sozialversicherungspflichtig. Nicht nur Freiberufler haben regelmäßig mit dieser Abgrenzung zu kämpfen, sondern auch Arbeitnehmer in einem Angestelltenverhältnis, die durch ihre Arbeitgeber in krimineller Weise ausgebeutet und als scheinselbstständig geführt werden.
Hier gilt es, die Abgrenzung zwischen einem Dienstvertrag im Angestelltenverhältnis (§ 611 BGB) und einem Werk- bzw. Dienstleistungsvertrag für selbstständig beschäftigte Mitarbeiter (§§631, 611 BGB) vorzunehmen. Bei dieser Konstellation handelt es sich um Auftraggeber und Auftragnehmer, die regelmäßig projektbezogen, aber nicht regulär zusammenarbeiten. Der Auftragnehmer ist nicht in die Organisation des Auftraggebers eingereiht, sondern erbringt seine Leistung als freier Mitarbeiter.
Praxisbeispiel eines Ingenieurs
Ein Ingenieur führt als Auftragnehmer für seinen Auftraggeber, eine Baufirma, die Errichtung einer Seniorenresidenz durch. Grundlage für die Tätigkeit ist ein Werkvertrag, mit dem der Auftragnehmer seinem Auftraggeber einen Erfolg schuldet. Die Vergütung erfolgt mit Abnahme des Werkes (§§ 640, 641 BGB), womit der selbstständige Unternehmer in Vorleistung geht. Werkverträge unterliegen den kaufrechtlichen Regelungen (§ 651 BGB).
Oft werden jedoch abweichende Vereinbarungen zwischen den Parteien vereinbart. Übersetzer, Journalisten, Texter, Rechtsanwälte und Ärzte werden regelmäßig als freiberuflich Tätige eingestuft, wenn nicht die Voraussetzungen eines Angestelltenverhältnisses vorliegen. Sie sind auf Grundlage eines Dienstleistungs- oder Honorarvertrages tätig und schulden ihrem Auftragnehmer keinen Erfolg wie beim Werkvertrag, sondern eine Tätigkeit mit Sorgfaltsverbindlichkeit. Auch sie arbeiten projektbezogen für ihren Auftraggeber (Unternehmen, Privatpersonen, Mandanten oder Patienten). Beispiel: Ein Patient ist Auftraggeber für seinen behandelnden Arzt. Dieser kann seinen Patienten regelmäßig keine Garantie auf eine erfolgversprechende Behandlung mit Heilung ihrer Leiden geben, sondern unterliegt lediglich einer Sorgfaltspflicht, mit der er die Behandlung nach bestem Wissen und Gewissen durchzuführen hat.
Wie kann die Scheinselbstständigkeit vermieden werden?
Freiberufler können die Gefahr einer Scheinselbstständigkeit umgehen, indem sie im Vertrag mit ihrem Auftraggeber ihren Arbeitsort, die Auswahl ihrer Aufträge und ihre Arbeitszeit frei vereinbaren und eine Kündigungsschutzklausel (erfahren Sie mehr zum Thema Kündigungsfrist als freier Mitarbeiter) vermeiden. Sie behalten sich vor, für weitere Auftraggeber tätig zu werden und reihen sich nicht in die Organisation des Auftraggebers ein. Ferner sollten Freiberufler nach einem Jahr den Auftraggeber wechseln, sollten sie ausschließlich für einen tätig sein und eine Bestätigung verlangen, dass die lange Wirkungszeit und Zusammenarbeit projektbezogen war.
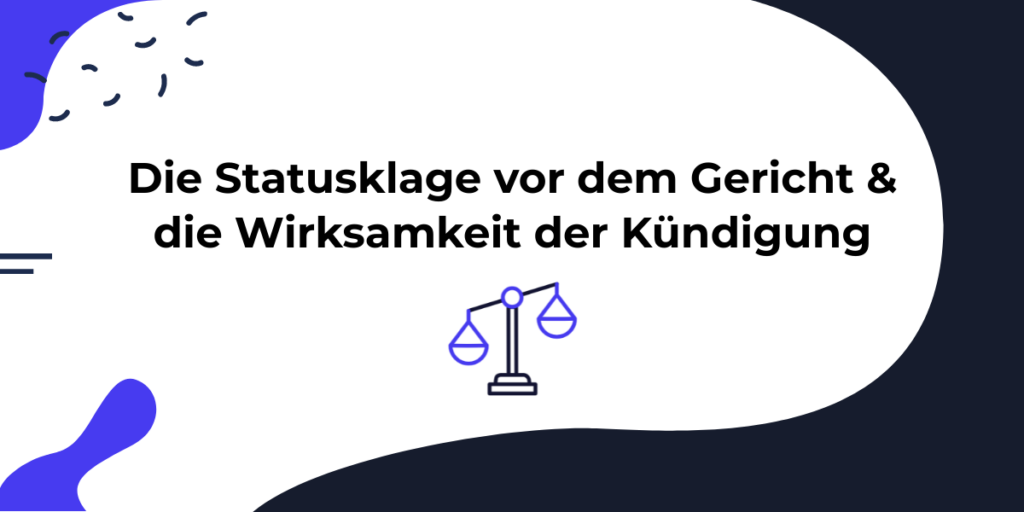
Die Statusklage vor dem Arbeitsgericht
Werden erwerbstätige Personen vorsätzlich durch ihren Arbeitgeber ausgebeutet oder von einem Angestelltenverhältnis in eine Scheinselbstständigkeit gezwungen, haben sie gemäß der regelmäßigen Rechtsprechung die Möglichkeit, sich in das Unternehmen einzuklagen. Der Rechtsgedanke von § 84 HGB definiert Arbeitnehmer als Beschäftigte, die weisungsgebunden fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Leistung erbringen müssen. Der Arbeitnehmer kann durch die Statusklage (§ 256 ZPO) vor dem Arbeitsgericht verbindlich feststellen lassen, ob eine Scheinselbstständigkeit vorliegt oder nicht.
Das Gericht prüft zunächst die sachliche Zuständigkeit und erhebt im Zweifelsfall Beweis über das Arbeitsverhältnis und durchleuchtet das Tätigkeitsfeld des vermeintlich selbstständigen Mitarbeiters. Das Arbeitsgericht hat zu klären, ob ein Rechtsverhältnis zwischen den beiden Parteien besteht oder nicht. Wird eine Scheinselbstständigkeit positiv festgestellt, wandelt sich diese in ein reguläres Angestelltenverhältnis mit allen Rechten und Pflichten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer um.
Welche rechtliche Wirkung hat eine Kündigung?
Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer bei den Sozialversicherungen anmelden und rückwirkend für den Zeitraum der Scheinselbstständigkeit die Beiträge zu den Sozialversicherungen entrichten, einschließlich des Arbeitnehmeranteils. Die Parteien sind jetzt Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mit allen rechtlichen Konsequenzen. Der Arbeitnehmer bekommt sein Gehalt nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge als Nettogehalt ausgezahlt.
Selbst wenn ein als selbstständig geführter Mitarbeiter durch seinen Auftraggeber gekündigt wird, hat er im Fall einer erfolgreichen Statusklage vor dem Arbeitsgericht das Recht auf Wiederanstellung, da die Kündigung durch den Arbeitgeber rechtlich unwirksam ist. Eine rechtliche Wirksamkeit kommt der Kündigung ausschließlich dann zu, wenn der Mitarbeiter weniger als sechs Monate im Unternehmen tätig war, unter keinen Umständen einen Kündigungsschutz genießt und es sich um einen Kleinbetrieb mit weniger als zehn Mitarbeitern handelt.
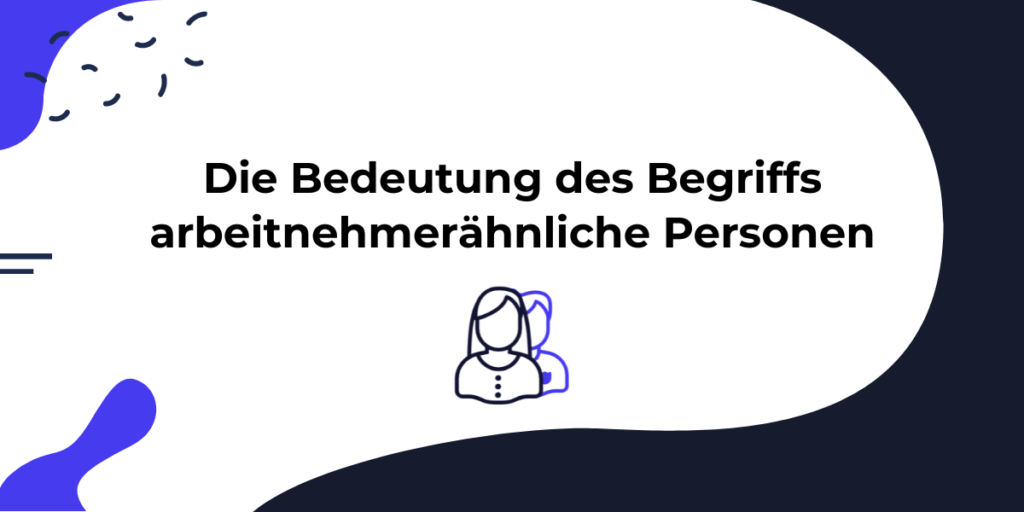
Was bedeutet der Begriff arbeitnehmerähnliche Personen?
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 04.11.1998, Aktenzeichen VIII ZB 12/98
Ein Franchisenehmer klagte gegen seinen Franchisegeber auf Feststellung eines ordentlichen und regulären Arbeitsverhältnisses, mit Erfolg. Der Rechtsstreit ging durch mehrere Instanzen bis vor den Bundesgerichtshof. Die Bundesrichter gaben dem Kläger recht und erkannten seine Verkaufstätigkeit aufgrund eines Partnerschaftsvertrages für den beklagten Franchisegeber als reguläres Angestelltenverhältnis an. Schon dem Vertrag nach sei die Tätigkeit des Klägers so ausgerichtet gewesen, dass eine ausschließliche Tätigkeit für den Franchisegeber vorliege.
Das Einkommen lag nach Meinung der Richter im unteren Bereich und war nicht dazu geeignet, eine adäquate Alters- und Krankheitsvorsorge zu garantieren. Ferner stand der Aufwand des Klägers in keinem Verhältnis zu dem Entgelt, das ihm der beklagte Franchisegeber zahlte. Auch konnte der Beklagte nicht nachweisen, dass die erzielten Umsätze und Gewinne des Klägers noch steigerungsfähig gewesen wären. Allerdings hätte auch das nichts an den Umständen geändert, denn der Kläger hatte nach Abzug aller Steuern und Sozialversicherungsbeiträge kaum die Chance, seinen Lebensstandard anständig zu bestreiten und hatte darüber hinaus das wirtschaftliche Risiko seines Franchiseunternehmens zu tragen.
Die Richter erkannten die wirtschaftliche Abhängigkeit des Klägers vom Unternehmen des Beklagten an, da er über seine Tätigkeit hinaus über keine weiteren Einkünfte verfügte. Der Kläger setzte demnach seine volle Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit alleine für die Beklagte ein. Die Bundesrichter schlossen sich der regelmäßigen Rechtsprechung an und stuften den Kläger gemäß § 5 ArbeitsG als abnehmerähnliche Person ein. Arbeitnehmerähnliche Personen sind zwar keine unselbstständig beschäftigten Personen wie Arbeitnehmer, jedoch besteht auch bei ihnen ein hoher Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit zum Arbeitgeber.
Auch arbeitnehmerähnliche Personen reihen sich ähnlich wie freiberuflich Tätige nicht in die Organisation und den Betriebsablauf des Arbeitgebers/Auftragsgebers ein und sind zeitlich und persönlich unabhängig. Jedoch ist das Merkmal ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit so signifikant, dass diese Erwerbstätigen hinsichtlich ihrer sozialen Stellung ähnlich einem Arbeitnehmer vergleichbar sozial und rechtlich schutzbedürftig sind.
Kann unbeabsichtigte illegale Beschäftigung geahndet werden?
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.07.2009, Aktenzeichen L6R 105/09
Beschäftigen Unternehmen Personen ohne soziale und gesetzliche Absicherung, begehen sie eine Ordnungswidrigkeit und verstoßen gegen das Gesetz gegen Schwarzarbeit. Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz hat mit seiner Rechtsprechung den Kampf gegen illegale Beschäftigung von Schwarzarbeitern und Scheinselbständigen verschärft. In diesem Fall hatte ein Handwerksbetrieb einen polnischen Arbeiter als „Subunternehmer“ im Rahmen einer Scheinselbstständigkeit beschäftigt. Als Nettolohn erhielt der nach außen selbstständige Subunternehmer zehn Euro.
Dieses Vorgehen blieb bis zu einer Betriebsprüfung zwei Jahre lang unentdeckt. Die prüfende Behörde entschied zwar, dass der Beschäftigte rein formal als selbstständig einzustufen sei, tatsächlich liege jedoch ein hoher Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit in seiner Tätigkeit für nur einen Auftraggeber vor. Die Behörde forderte von dem Arbeitgeber die Nachzahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung in Höhe von 10.000 Euro. Hiergegen wehrte sich der Arbeitgeber und zog vor Gericht, jedoch ohne Erfolg.
Die Richter entschieden, dass es nicht auf die Absicht der beiden Beteiligten ankomme. In diesem Fall verlief die Beschäftigung des polnischen Arbeiters im Rahmen einer Scheinselbstständigkeit im gegenseitigen Einvernehmen. Bei der Beurteilung, ob eine illegale Scheinselbstständigkeit vorliegt oder nicht, kommt es regelmäßig nicht auf die subjektiven, sondern auf die objektiven Tatbestände an.
Die vorliegenden Umstände sprachen eindeutig gegen eine selbstständige Arbeit des polnischen Arbeiters und für eine abhängige und reguläre Beschäftigung im Betrieb des Arbeitgebers. Erschwerend kam hinzu, dass der polnische Arbeiter keine eigene Betriebsstätte mit einem eigenen Briefkasten unterhielt, keine Kundenakquise betrieb, keine Rechnungsstellung vornahm und nicht über persönliche Betriebsmittel verfügte.
Er übte seine Tätigkeit ausschließlich auf Weisungsgrundlage seines Arbeitgebers aus, konnte sich seine Arbeitszeit nicht frei einteilen und seinen Arbeitsort nicht frei wählen. Die Richter entschieden, der Inhaber des Handwerksbetriebes habe gegen seine Meldepflicht hinsichtlich einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit verstoßen. Die Konsequenz dieser Entscheidung war, dass die an den Arbeitnehmer gezahlten 10 Euro Nettolohn nun nicht mehr als Nettolohnvereinbarung angesehen, sondern entsprechend der höchsten Steuerklasse VI angesetzt wurde und rückwirkend mit den Sozialversicherungen abzurechnen war. Diese Einstufung wird immer dann vorgenommen, wenn ein illegales Beschäftigungsverhältnis vorliegt und eine Steuerkarte des Arbeitnehmers als Grundlage für die Berechnung der zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge nicht existiert.
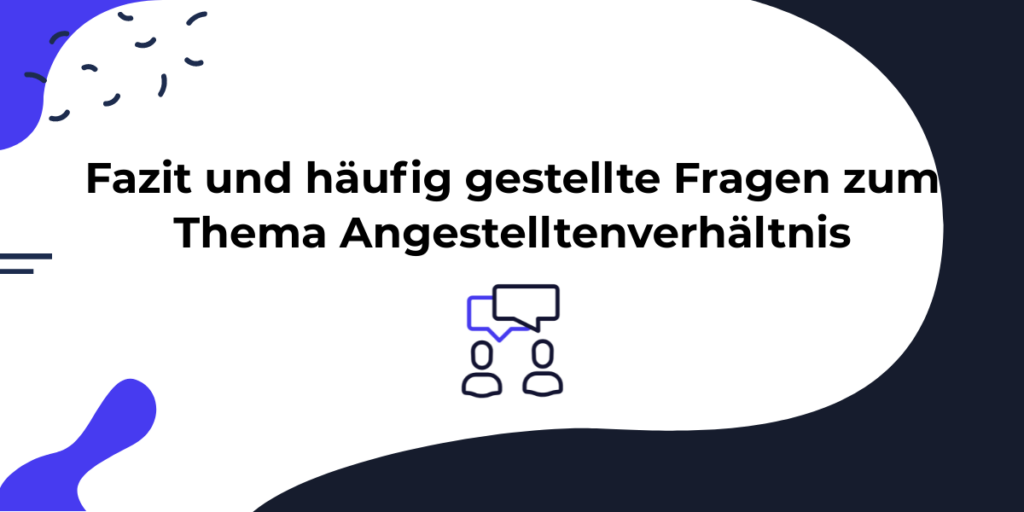
Fazit zum Angestelltenverhältnis
Das Angestelltenverhältnis ist ein komplexes Konstrukt, das durch zahlreiche Gesetze und Vorschriften geregelt ist. Es bietet dem Arbeitnehmer soziale Sicherheit, aber auch Einschränkungen in der Arbeitsgestaltung. Scheinselbstständigkeit ist ein riskantes Terrain, das sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer erhebliche rechtliche Konsequenzen haben kann. Daher ist es wichtig, die Unterschiede und rechtlichen Rahmenbedingungen genau zu kennen und zu beachten.

Häufig gestellte Fragen zum Thema Angestelltenverhältnis & Scheinselbstständigkeit
Wir haben die am häufigsten gestellten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was ist der Unterschied zwischen Arbeiter und Angestellte?
Arbeiter und Angestellte sind beides Arbeitnehmer, jedoch unterscheiden sie sich in der Art ihrer Tätigkeit und oft auch in der Höhe ihrer Vergütung. Arbeiter sind in der Regel in handwerklichen, technischen oder gewerblichen Berufen tätig. Sie werden oft nach Stunden bezahlt und haben in der Regel weniger Verantwortung im Vergleich zu Angestellten. Angestellte hingegen sind meist in kaufmännischen, verwaltenden oder akademischen Berufen tätig und haben oft mehr Verantwortung. Sie erhalten in der Regel ein monatliches Gehalt. Die Unterscheidung hat auch rechtliche Relevanz, etwa bei Kündigungsfristen oder Tarifverträgen.
Was ist der Unterschied zwischen Angestellten und Selbstständigen?
Angestellte sind weisungsgebunden und erhalten ein festes Gehalt, während Selbstständige ihre Arbeitszeit und -ort in der Regel frei wählen können und für ihre eigenen Sozialversicherungsbeiträge aufkommen müssen. Selbstständige sind nicht weisungsgebunden und tragen ein unternehmerisches Risiko, da ihr Einkommen von der Auftragslage abhängt.
Was ist ein Angestelltenverhältnis?
Ein Angestelltenverhältnis ist eine sozialversicherungspflichtige Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die auf einem Arbeitsvertrag basiert. Dieser regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, einschließlich Arbeitszeit, Gehalt, Urlaub und Kündigungsfristen. Das Angestelltenverhältnis bietet dem Arbeitnehmer soziale Sicherheit, aber auch weniger Freiheit in der Gestaltung seiner Arbeit im Vergleich zu einem Selbstständigen.
Ist ein Mitarbeiter ein Angestellter?
Der Begriff “Mitarbeiter” ist allgemeiner und kann sowohl Angestellte als auch Arbeiter, Praktikanten oder sogar Freiberufler umfassen, die für ein Unternehmen tätig sind. Ein Angestellter ist jedoch immer ein Mitarbeiter, der in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis steht.