- Firmengründung
- Lesezeit: 07:17 Minuten
GmbH Stammkapital: Höhe, Einlage & Verwendung
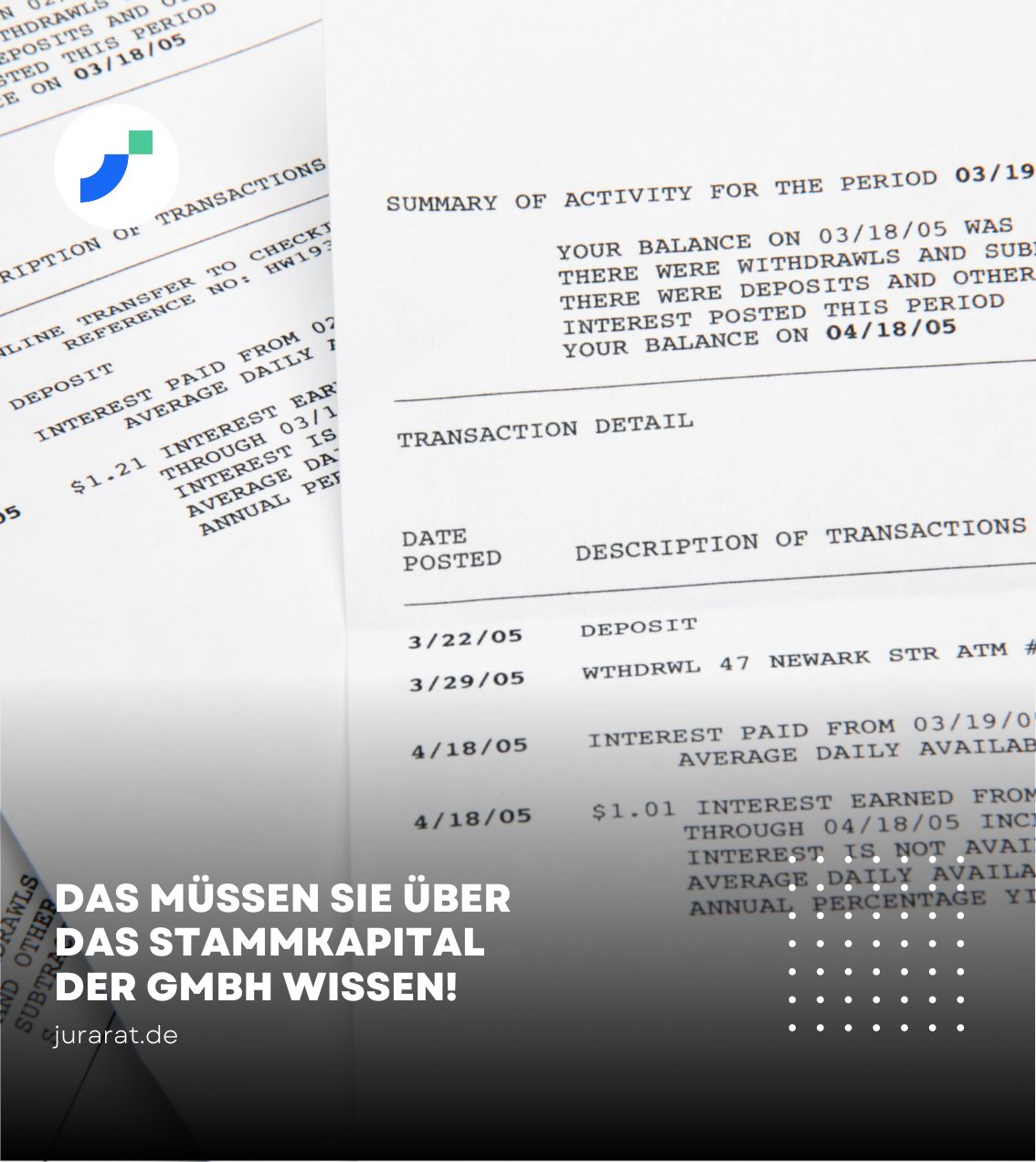
- Für Gläubiger der GmbH stellt das Stammkapital eine Sicherheit dar, bis zu dessen Höhe ihre Forderungen befriedigt werden können.
- Nach § 5 Abs. 1 GmbHG muss das Stammkapital einer GmbH mindestens 25.000 Euro betragen, wobei eine höhere Stammeinlage die Bonität und Geschäftschancen verbessern kann.
- Für die Gründung einer GmbH reicht es, wenn mindestens 12.500 Euro als Bareinlage geleistet werden, gemäß § 7 Abs. 2 GmbHG.
- Im Gegensatz zu Bareinlagen müssen Sacheinlagen in vollem Umfang vor der Anmeldung der GmbH ins Handelsregister geleistet sein.
- Obwohl das Stammkapital nicht an Gesellschafter ausgezahlt werden darf, kann es für Geschäftsaktivitäten wie Mitarbeiterzahlungen oder Begleichung von Forderungen genutzt werden.
- Die UG ermöglicht die Gründung mit deutlich geringerem Stammkapital und kann ein Weg zur späteren Umwandlung in eine GmbH sein.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist die in Deutschland häufigste Gesellschaftsform und bietet viele Vorteile für Unternehmer. Die Haftung der GmbH ist auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt, die Gesellschafter müssen also nicht wie bei einem Einzelunternehmen oder einer GbR mit ihrem Privatvermögen einspringen. Außerdem bietet die GmbH auch steuerliche Vorteile. Neben dem Abschluss eines Gesellschaftsvertrags und der Anmeldung der GmbH im Handelsregister ist die wichtigste Voraussetzung der Gründung einer GmbH die Einbringung des sogenannten Stammkapitals, mit dem sich dieser Beitrag insbesondere beschäftigt.

Was ist das Stammkapital?
Das Stammkapital der Gesellschaft kann auch als „Haftungsfonds“ bezeichnet werden. Gläubiger der Gesellschaft können sich darauf verlassen, dass zumindest bis zur Höhe des Stammkapitals der GmbH ihre Forderungen befriedigt werden. Vereinfacht kann man sich das Stammkapital so vorstellen: Die Gesellschafter der GmbH bringen eine bestimmte Summe an Kapital in die Gesellschaft ein. Damit wird ihr Kapital zum Eigenkapital der GmbH, dem Stammkapital. Dieses Stammkapital muss grundsätzlich erhalten werden, insbesondere darf es nicht an die Gesellschafter ausgezahlt werden, § 30 GmbHG. Hierdurch erhalten die Gläubiger der GmbH eine gewisse Sicherheit. Das Stammkapital ist damit auch gleichzeitig der Grund dafür, dass die GmbH keine Haftung ihrer Gesellschafter vorsieht: Die Gesellschafter werden quasi mit der Aufbringung des Stammkapitals mit einer Haftungsbeschränkung „belohnt“.
Wie hoch beträgt das Stammkapital einer GmbH?
Gemäß § 5 Abs. 1 GmbHG muss das Stammkapital mindestens 25.000 Euro betragen. Darüber hinaus steht es im Ermessen der Gesellschafter, wie hoch sie das Stammkapital bemessen wollen. Eine Kapitalerhöhung bzw. höhere Stammeinlage bietet sich beispielsweise dann an, wenn die GmbH größere Aufträge annehmen möchte: Geschäftspartner werden sich im Zweifel nämlich über die Höhe des Stammkapitals der GmbH informieren. Je höher das Stammkapital ausfällt, desto gewillter sind die Geschäftspartner im Zweifel, den Auftrag der GmbH zu erteilen. Auch bietet sich eine Kapitalerhöhung an, falls die GmbH einen Kredit bei einer Bank aufnehmen möchte. Das höhere Stammkapital führt zu einer höheren Bonität, was sich regelmäßig positiv auf die Krediterteilung auswirkt.
Kann man eine GmbH mit 12.500 Euro gründen?
Ja, eine Erleichterung dieser Regelung bezüglich des Stammkapitalerfordernisses von 25.000 Euro ergibt sich aber für die Gründung der GmbH, sofern eine Bareinlage vorgesehen ist. Für die Gründung reicht es nämlich aus, dass die Hälfte des Mindeststammkapitals, also mindestens 12.500 Euro, in diesem Zeitpunkt als Einlage geleistet wurden, § 7 Abs. 2 GmbHG.
Kann man die 12.500 Euro in Form einer Sacheinlage leisten?
Nein, anders sieht dies wiederum bei der Sacheinlage (dazu unten mehr) aus. Sacheinlagen müssen in vollem Umfang bereits vor der Anmeldung der GmbH ins Handelsregister geleistet sein, § 7 Abs. 3 GmbHG.
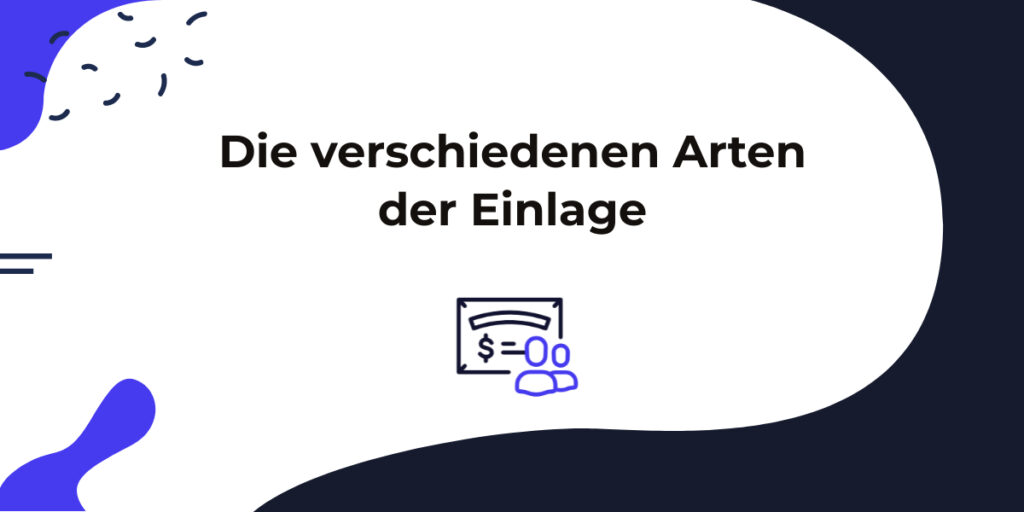
Wie kann die Einlage erbracht werden?
Die Einlage kann auf verschiedene Arten erbracht werden.
1. Bareinlage
Anders, als der Name vermuten lässt, ist für die Bareinlage keine Barzahlung, beispielsweise in eine Kasse der Gesellschaft, vorgeschrieben. In der Praxis erfolgt die Bareinlage meist durch eine Zahlung auf das Bankkonto der Gesellschaft.
2. Sacheinlage
Die Einlage kann jedoch auch in Form einer Sacheinlage erfolgen. Hierbei wird keine Bareinlage erbracht, sondern Sachen oder sonstige Vermögenswerte & Wirtschaftsgüter. Hierzu können zum Beispiel zählen:
- immaterielles Vermögen (zum Beispiel Marken- und Patentrechte, Lizenzen, Webseiten)
- bewegliches Vermögen (zum Beispiel Büroausstattung, Fahrzeuge, Maschinen, Rohstoffe)
- unbewegliches Vermögen (beispielsweise Grundstücke, Immobilien)
- Forderungen
- Unternehmen als solche bzw. Beteiligungen an anderen Unternehmen
Der konkrete Wert der Sacheinlage ist jedoch nicht so einfach feststellbar wie bei der Bareinlage und birgt daher die Gefahr einer Überbewertung, die die Gläubiger benachteiligt. Angesichts dessen existieren besondere Vorschriften, die eine genaue Kontrolle der Sacheinlagen vorschreiben. Erforderlich ist daher ein sogenannter Sachgründungsbericht. Dieser muss von allen Gründungsgesellschaftern unterzeichnet werden. Da er nicht direkt Bestandteil des Gesellschaftsvertrags ist, ist eine notarielle Beurkundung des Sachgründungsberichts nicht erforderlich.
In diesem sind sämtliche für die Bewertung der Sacheinlage maßgeblichen Umstände aufzunehmen. Dazu zählen beispielsweise der Anschaffungspreis, Marktpreise, Nutzungsmöglichkeiten oder der Zustand der Sache. Wie diese Bewertungen belegt und bewiesen werden, ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Wichtig ist nur, dass die Gesellschafter nachweisen können, dass die Bewertung des einzubringenden Gegenstandes angemessen ist, § 8 Abs. 1 Nr. 5 GmbH Gesetz (GmbHG). Als Nachweis hierfür können etwa Rechnungen, Preislisten oder Sachverständigengutachten dienen. Maßgeblich ist stets der tatsächliche Wert im Zeitpunkt der Anmeldung der Gesellschaft, § 9 Abs. 1 GmbHG.
Wird ein anderes Unternehmen, etwa ein einzelkaufmännisches Unternehmen oder eine GbR in die GmbH als Sacheinlage eingebracht, müssen außerdem die Jahresergebnisse der beiden letzten Geschäftsjahre angegeben werden, § 5 Abs. 4 S. 2 GmbHG.
Bei der Erstellung des Sachgründungsberichts sollten Sie besonders sorgfältig vorgehen: Falsche Angaben führen nämlich zu einer Haftung nach § 9a GmbHG, wonach die Gesellschafter der Gesellschaft gegenüber auf Schadensersatz leisten. Obendrein können falsche Angaben sogar zu einer strafrechtlichen Verurteilung führen, § 82 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG.
3. Mischeinlage
Zulässig ist auch die sogenannte Mischeinlage. Hierbei wird ein Teil des benötigten Stammkapitals als Bareinlage erbracht, der übrige Teil in Form von Sacheinlagen.
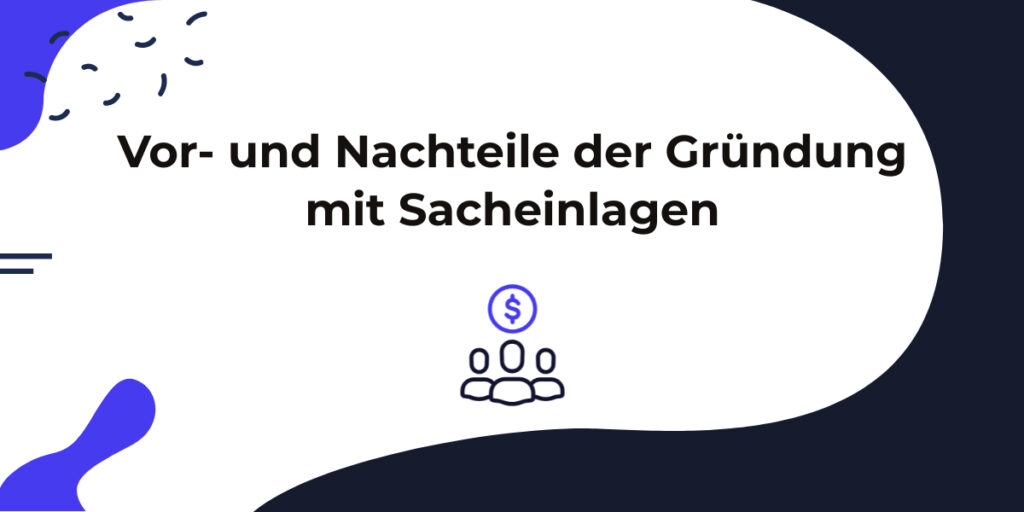
Was sind die Vor- und Nachteile bei der GmbH Gründung mit Sacheinlage?
Der größte Vorteil einer GmbH Gründung mit Sacheinlage liegt wohl darin, dass diese Variante eine GmbH Gründung ermöglicht, obwohl die Gesellschafter keine liquiden Mittel zur Verfügung haben, die sie als Bareinlage einbringen könnten. Außerdem kann man häufig „zwei Fliegen mit einer Klappe“ schlagen: Benötigt die neu gegründete GmbH beispielsweise ein Grundstück für die Produktion oder bestimmte Gegenstände wie Fahrzeuge oder Maschinen, müssen diese nicht extern eingekauft werden, sondern können, sofern diese einem Gesellschafter ohnehin schon gehören, als Sacheinlage eingebracht werden.
Größter Nachteil und gleichzeitig auch Grund dafür, dass in Deutschland die wenigsten Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit Sacheinlage gegründet werden, ist der hohe Zeit- und Kostenaufwand. Der Wert der Sacheinlagen muss aufwendig durch einen Gutachter ermittelt werden. Wenn lediglich einige wenige Gegenstände als Sacheinlage eingebracht werden, erweist sich die Wertermittlung als relativ unkompliziert. In den meisten Fällen geht es jedoch um eine Vielzahl von Gegenständen oder Rechten, deren Wert allesamt gesondert ermittelt und erfasst werden müssen. Dies führt zu einem hohen bürokratischen Aufwand und lässt auch die Kosten für die Eintragung der GmbH ins Handelsregister ansteigen.
Kann das Stammkapital einer GmbH frei verwendet werden?
Ein weitverbreiteter Irrglaube ist, dass das Stammkapital der GmbH unangetastet auf einem Bankkonto liegen und alleine dem Zweck dienen muss, im Falle eines Zahlungsausfalls als Kapital für die Gläubiger dient. Die Stammeinlage darf jedoch auch zu Gesellschaftszwecken investiert und ausgegeben werden, beispielsweise um Mitarbeiter zu bezahlen oder Forderungen von Geschäftspartnern zu begleichen. Eine Auszahlung an die Gesellschafter ist dabei aber nicht erlaubt, § 30 Abs. 1 GmbHG.
Ich habe noch keine Möglichkeit, die Mindesteinlage zu erbringen. Gibt es eine Alternative?
Mit 25.000 Euro ist das gesetzlich geforderte Mindeststammkapital nicht gerade gering. Aus gutem Grund gibt es also viele Gründer, die eine Gesellschaft mit einer Haftungsbeschränkung gründen wollen, allerdings bislang nicht über ausreichendes Stammkapital verfügen. Dieses Problem hat 2008 auch der Gesetzgeber erkannt und die sogenannte Unternehmergesellschaft, auch UG (haftungsbeschränkt) genannt, eingeführt. Diese wird häufig auch als „Mini-GmbH“ oder „1-Euro-GmbH“ bezeichnet. Die UG kann bereits ab einem Euro pro Gesellschafter gegründet werden. Die Einlage muss dabei aber stets als Bareinlage geleistet werden, Sacheinlagen sind bei der UG (haftungsbeschränkt) nicht zulässig.
Weiteres besonderes Merkmal der UG (haftungsbeschränkt) ist, dass sie nur 75 % ihres Jahresabschlusses an die Gesellschafter ausschütten darf, es müssen stets mindestens % 25 als Rücklage dienen. Diese Verpflichtung fällt erst weg, wenn die Rücklagen über die Jahre auf 25.000 Euro angewachsen sind. Ab diesem Zeitpunkt kann die UG (haftungsbeschränkt) in eine GmbH umgewandelt werden.
Die Gründung einer UG ebnet gewissermaßen den Weg zur ursprünglich anvisierten GmbH Gründung. Das Unternehmen kann bereits den Betrieb aufnehmen und die stetig wachsenden Rücklagen führen über die Jahre dazu, dass das anfänglich bislang nicht verfügbare Mittel für die Erbringung des Stammkapitals, letztendlich doch erbracht werden kann.

Fazit: Das GmbH Stammkapital im großen Überblick
Das Stammkapital ist ein fundamentaler Bestandteil der GmbH-Gründung, der sowohl für die finanzielle Absicherung der Gläubiger als auch für die Haftungsbeschränkung der Gesellschafter sorgt. Mit einem Mindeststammkapital von 25.000 Euro, das auch als Bareinlage zur Hälfte (12.500 Euro) erbracht werden kann, bietet die GmbH-Form Flexibilität und Sicherheit. Alternativ können Gründer auf die UG (haftungsbeschränkt) zurückgreifen, um mit geringerem Kapital zu starten.

Häufig gestellte Fragen rund um das Stammkapital einer GmbH
Wir haben die am häufigsten Fragen für Sie gesammelt und beantwortet!
Was passiert mit den 25.000 € bei einer GmbH?
Die 25.000 €, die als Stammkapital für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erforderlich sind, dienen als Sicherheit für Gläubiger der Gesellschaft. Sie können zur Erfüllung von Gesellschaftszwecken investiert und ausgegeben werden, beispielsweise um Mitarbeiter zu bezahlen oder Forderungen von Geschäftspartnern zu begleichen. Eine Auszahlung an die Gesellschafter ist jedoch nicht erlaubt.
Wie viel Stammkapital braucht man für eine GmbH?
Mindestens 12.500 Euro. Für die Gründung einer GmbH ist nach deutschem Recht ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro erforderlich. Dieses Kapital muss bei der Gründung der GmbH zur Verfügung stehen und kann entweder in voller Höhe oder zur Hälfte als Bareinlage erbracht werden.
Was sagt das Stammkapital einer GmbH aus?
Das Stammkapital einer GmbH gibt Auskunft über die finanzielle Ausstattung der Gesellschaft bei der Gründung. Es dient als Sicherheit für die Gläubiger der Gesellschaft und ist ein Indikator für die finanzielle Stabilität und Solvenz der GmbH.